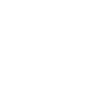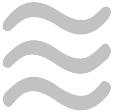GESUNDHEITSFRAGEN RICHTIG IM VERSICHERUNGSANTRAG BEANTWORTEN | SO FÜLLEN SIE DIE GESUNDHEITSFRAGEN RICHTIG FÜR DEN LEISTUNGSFALL AUS
LEISTUNGSFALL OHNE ÄRGER | SO FÜLLEN SIE DIE GESUNDHEITSFRAGEN RICHTIG AUS!
GEFÄHRLICHE HALBWAHRHEITEN: SO FÜLLEN SIE DIE GESUNDHEITSFRAGEN IM VERSICHERUNGSANTRAG RICHTIG AUS!

GESUNDHEITSFRAGEN IM ANTRAG: EHRLICHKEIT ZAHLT SICH AUS - TIPPS UND TRICKS FÜR DIE RECHTSKRÄFTIGEN UND VOLLSTÄNDIGEN ANGABEN IM VERSICHERUNGSANTRAG
Um die Gesundheitsfragen in einem Versicherungsantrag korrekt und rechtskräftig auszufüllen, müssen alle Angeben vollständig, wahrheitsgemäß und so präzise wie möglich erfolgen. Falsche, unvollständige oder verschleierte Angaben können als erstes bei der Antragsannahme zu Problemen führen oder später im Leistungsfall zur Leistungsverweigerung oder rückwirkenden Kündigung des Vertrags führen.
WELCHE VERSICHERUNGSARTEN VERLANGEN EINE GESUNDHEITSPRÜFUNG ODER GESUNDHEITSFRAGEN IM VERSICHERUNGSANTRAG, BEVOR DER VERTRAG UND DIE LEISTUNGSZUSAGE ABGESCHLOSSEN WERDEN KANN?
| Versicherungssparte | Absicherungsgrund | Sinn und Vorteil für Privatpersonen |
| Berufsunfähigkeitsversicherung (BUR) | Schutz vor Einkommensverlust durch dauerhafte Arbeitsunfähigkeit | Sichert das eigene Einkommen und damit den Lebensstandard ab |
| Risikolebensversicherung | Auszahlung eines vereinbarten Betrags bei Tod der versicherten Person | Existenzielle Absicherung der Hinterbliebenen/Finanzlücken abdecken |
| Private Krankenvollversicherung | Schutz vor Krankheits- und Behandlungskosten (je nach Tarif umfassender als GKV) | Auswahl individueller Leistungen, ggf. bessere Versorgung, Entlastung bei hohen Kosten |
| Private Krankenzusatzversicherung | Ergänzung der gesetzlichen Krankenversicherung, z.B. für Zahnersatz, Krankenhaus, Krankentagegeld (TG) | Bessere Versorgungslücken schließen, z.B. Zahnersatz, Einbettzimmer oder Einkommensverlust nach 6 Wochen. |
| Private Pflegezusatzversicherung | Absicherung gegen die finanziellen Folgen von Pflegebedürftigkeit | Schutz vor immensen Pflegekosten, Entlastung der Familie |
| Unfallversicherung | Auszahlung bei dauerhaften körperlichen Schäden nach Unfall | Zusätzliche Absicherung, speziell bei risikoreichen Tätigkeiten |
| Kapitallebensversicherung | Lebenslange oder zeitlich befristete Absicherung plus Sparanteil, Todesfallschutz | Kombination aus Vorsorge (z.B. für Familie) und Kapitalbildung |
| Erwerbsunfähigkeitsversicherung |
Schutz bei vollständiger Aufgabe jeglicher Erwerbstätigkeit | Ergänzung/zum Teil Alternative zur BUR, falls keine BUR möglich |
| Schwere Krankheiten Absicherung | Auszahlung des einmal Kapitalbeitrages bei den versicherten schweren Krankheiten, um sorgenfrei das Leben der Familie oder sein eigenes zu bezahlen, wenn noch keine Berufsunfähigkeitsrente vorliegt und das Krankentagegeld nicht oder nur zu gering abgesichert wurde. | Ergänzung zum Teil zur BUR, falls keine BUR möglich oder des TG oder zu wenig abgesichert ist |
Erklärung zu den Sparten und deren Sinn
-
Berufsunfähigkeitsversicherung:
Wer wegen Krankheit oder Unfall dauerhaft nicht mehr im eigenen Beruf arbeiten kann, bekommt eine vereinbarte monatliche Rente. Diese wird als Berufsunfähigkeitsrente definiert. Diese Police ist für die finanzielle Existenzsicherung (z.B. laufende Lebenshaltungskosten, Kredite) besonders wichtig. In der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten die versicherten Personen, die nach 1961 geboren wurden keinen Berufsunfähigkeitsrente mehr, sondern nur eine Erwerbsminderungsrente.
Achtung zur Absicherung über die gesetzliche Rentenversicherung oder das berufsständische Versorgungswerk:
Diesen Versicherungsschutz, der durch den Staat abgesichert wird, kann man nicht mit der privaten Absicherung vergleichen, da in dem Versicherungsschutz vom Staat oder dem Versorgungswerk erhebliche Hürden zu überwinden sind, um diesen Versicherungsschutz zu erhalten. Deshalb sollte jede Person frühzeitig sich mit diesem Versicherungsschutz auseinandersetzen. Man kann diesen Versicherungsschutz vergleichen, wie die Pflichtversicherung der KFZ-Haftpflichtversicherung, nur das jeder Bürger oder Bürgerin sich selbst darum kümmern muss.
-
Risikotodesfalllebensversicherung:
Im Todesfall wird eine hohe Einmalsumme an die Hinterbliebenen gezahlt. Sie dient vor allem zur Absicherung von Familienmitgliedern (z.B. Kinder (Sicherung der zukünftigen Ausbildungskosten), Ehepartner (Stressfreie Neuorientierung), Immobilienfinanzierung (Darlehensschuld kann sofort getilgt werden, ohne das zeitnah ein Auszug durch den Rausschmiss erfolgt).
Wichtiger Hinweis zur Risikotodesfalllebensversicherung:
In der Kalkulation sollte immer eine längere Vertragslaufzeit berücksichtigt werden, da in der Regel im Laufe der Zeit Krankheiten entstehen, mit diesen kann die Annahme des erneut gewünschten Risikoschutzes nicht oder nicht zu den gewünschten Konditionen angenommen werden. Gleichzeitig sollte die zu bezahlende Erbschaftssteuer berücksichtigt werden, die im Leistungsfall an die bezugsberechtigte Person durch die Auszahlung der Todesfallleistung fällig wird.
-
Private Krankenvollversicherung:
Privatversicherte erhalten meist individuelle, teilweise bessere oder umfassendere medizinische Leistungen als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Nur Selbstständige, Freiberufler oder Arbeitnehmer, die über der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung können sich für den Lösungsweg in der privaten Krankenversicherung entscheiden.
Wichtiger Hinweis zur privaten Krankenversicherung:
Die private Krankenversicherung sollte nie über den Beitrag ausgesucht werden. Es sollten immer die Leistungen im Vordergrund stehen, da Sie beim Wechsel zur privaten Krankenversicherung immer als Selbstzahler für die ihnen erbrachten Leistungen haften.
-
Private Krankenzusatzversicherung:
Für gesetzlich Versicherte bietet diese Zusatzpolice Schutz bei spezifischen Risiken, etwa bessere Zahnbehandlungen oder Krankenhausroutinen, die nicht von der GKV gedeckt werden. In der Regel können sich Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung den Status eines Privatpatienten (Mitglied einer privaten Krankenversicherung) nur für das Krankenhaus und im Zahnbereich sichern. Im ambulanten Bereich gibt es ebenfalls eine Möglichkeit, allerdings ist dort eine 100 % Leistungserstattung gleichgültig der Versicherungsgesellschaft nicht garantiert.
-
Private Pflegezusatzversicherung:
Deckt die erheblichen Kosten ab, die im Pflegefall entstehen können, wenn Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht ausreichen. Somit bleibt das Privatvermögen besser geschützt.
-
Unfallversicherung:
Bei bleibenden Gesundheitsschäden nach Unfällen (z. B. Invalidität) wird eine festgelegte Geldsumme gezahlt; dies ist besonders für Menschen mit risikoreichen Freizeit- oder Arbeitsaktivitäten relevant.
-
Kapitallebensversicherung:
Diese Verbindung von Sparplan und Todesfallabsicherung dient neben dem Todesfallschutz auch dem Vermögensaufbau, z.B. für spätere Auszahlungen oder Altersvorsorge.
-
Erwerbsunfähigkeitsversicherung:
Im Falle vollständiger Erwerbsunfähigkeit (unabhängig vom Beruf) erhält man finanzielle Unterstützung; vor allem für Menschen sinnvoll, die keine BU-Versicherung erhalten oder ausüben können.
WARUM SIND DIE ANGABEN DER GESUNDHEITSFRAGEN SO WICHTIG UND WESHALB MÜSSEN DIE GESUNDHEITSANGABEN IM VERSICHERUNGSVERTRAG IMMER VOLLSTÄNDIG, WAHRHEITSGETREU UND PRÄZISE ANGEGEBEN WERDEN?
Die Angaben zu den Gesundheitsfragen in einem Versicherungsantrag sind rechtlich äußerst wichtig, weil sie die Basis für die Beurteilung des versicherten Risikos bilden und darüber entscheiden, ob und zu welchen Bedingungen der Versicherer den Vertrag abschließt. Es besteht eine vorvertragliche Anzeigepflicht, die im deutschen Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in § 19 Abs. 1 geregelt ist. Diese Pflicht verpflichtet den Versicherungsnehmer, alle ihm bekannten Gefahrumstände, insbesondere Gesundheitsangaben, die für den Versicherer relevant sind und nach denen er in Textform gefragt wurde, vollständig, wahrheitsgemäß und präzise anzugeben.
Warum ist das so wichtig?
-
Versicherer müssen das Risiko einschätzen, ob und wie wahrscheinlich ein Schadensfall eintritt, um einen fairen Vertrag mit angemessenen Prämien kalkulieren zu können. Verzerrte oder unvollständige Angaben führen zu falscher Risikobewertung.
-
Werden Angaben absichtlich oder fahrlässig falsch oder unvollständig gemacht (z.B. Krankheiten verschwiegen), kann der Versicherer den Vertrag anfechten oder kündigen sowie bereits geleistete Versicherungsansprüche verweigern (§ 22 und § 56 VVG). Das bedeutet, der Versicherungsschutz entfällt im Leistungsfall, und der Versicherte bleibt auf Kosten sitzen.
-
Auch bereits erbrachte Versicherungsleistungen können zurückgefordert werden. Dies passiert, wenn sich herausstellt, dass der Versicherungsnehmer die Gesundheitsfragen nicht korrekt beantwortet hat.
-
Die Gesundheitsangaben müssen zeitlich und sachlich präzise sein. So sind beispielsweise alle Untersuchungen, Behandlungen und Diagnosen im gefragten Zeitraum anzugeben – auch wenn sie nur leicht oder vorübergehend waren. Selbst scheinbar harmlose Beschwerden oder Selbstmedikation können relevant sein.
-
Patienten können bei Unsicherheiten Arztakten oder Patientenquittungen zur Prüfung und Vollständigkeit der Angaben heranziehen. Versicherer prüfen die Angaben auch oft selbst durch Schweigepflichtentbindung von Ärzten. Diese muss in allen Versicherungsanträgen mit Gesundheitsfragen für die laufende Vertragslaufzeit frei gegeben werden oder man vereinbart, dass bei jeder Rückfrage des Versicherers, dieser eine einzelne Schweigepflichtentbindung bei Ihnen einholen muss.
Rechtskräftige Auswirkungen:
-
Die Rechtsprechung bestätigt, dass eine Verletzung der Anzeigepflicht durch unvollständige oder falsche Gesundheitsangaben den Versicherer zur Rückabwicklung des Vertrags berechtigt (Rücktritt oder Anfechtung). Dies wurde z.B. im Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt 2021 bekräftigt, das einen Rücktritt vom Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrag wegen verschwiegenen Gesundheitsproblemen erlaubte.
-
Die Angaben im Antrag sind keine reine Formalität, sondern ein wesentlicher Vertragsbestandteil. Ungenaue oder falsche Angaben setzen den Versicherungsschutz aufs Spiel und können nachträgliche Leistungskürzungen oder -verweigerungen verursachen.
Zusammenfassend:
Die vollständige, wahrheitsgetreue und präzise Angabe der Gesundheitsfragen ist unerlässlich, weil sie den Vertragsgrundlage bildet und den Versicherungsschutz sichert. Fehlen wichtige Gesundheitsinformationen oder werden diese falsch angegeben, kündigt der Vertragsschutz und der Versicherungsnehmer hat keine Leistungsansprüche, gerade im Schadensfall. Die rechtlichen Bestimmungen im VVG schützen den Versicherer vor falschen Angaben; deshalb ist die Sorgfalt bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen unerlässlich.
Diese rechtliche Pflicht schützt also beide Seiten: den Versicherer vor unvermuteten Risiken und den Versicherten vor späterem Leistungsentzug aufgrund von falschen oder verschwiegenen Angaben.
Beispiel für einen Rücktritt des Versicherungsschutzes in der Berufsunfähigkeitsrentenabsicherung:
Eine versicherte Person hatte in dem Versicherungsantrag zur Absicherung seine Berufsunfähigkeitsabsicherung leider nicht alle Gesundheitsangaben vollständig und richtig beantwortet. Bei Antragstellung von Zahlung der versicherten Berufsunfähigkeit wurden von der Versicherung die entsprechenden behandelnden Ärzte angeschrieben und um vollständig Auskunft der bestehenden Anamnese abgefragt. Hier stellte man diese massiven Differenzen der nicht präzise angegebenen Gesundheitsangaben fest und darauf trat der Versicherer von Versicherungsvertrag zurück (Urteil OLG Frankfurt / 17.11.2021 / AZ: 7 U 118/20)
GESUNDHEITSFRAGEN IM VERSICHERUNGSANTRAG: SO VERMEIDEN SIE GEFÄHRLICHE FALLEN!
Wenn im Rahmen eines Versicherungsantrags Gesundheitsfragen gestellt werden, hat dies einen klaren rechtlichen und versicherungstechnischen Hintergrund. Versicherer sind nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) verpflichtet, das Risiko, das sie absichern sollen, vor Vertragsabschluss zu prüfen und einzuschätzen. Grundlage dieser Risikoprüfung sind die Angaben des Antragstellers zu seiner gesundheitlichen Situation, zu Vorerkrankungen, zu laufenden Behandlungen, zu Medikamenteneinnahmen und zu sonstigen relevanten Umständen. Der Versicherer verwendet diese Angaben, um zu entscheiden, ob er den Antrag annimmt, ob er ihn eventuell nur unter bestimmten Bedingungen (zum Beispiel mit Risikozuschlägen oder Leistungsausschlüssen) annehmen kann oder ob er ihn ablehnt.
Für den Antragsteller ergibt sich daraus eine gesetzlich normierte Pflicht zur wahrheitsgemäßen und vollständigen Beantwortung aller Gesundheitsfragen. Diese Pflicht ist in § 19 VVG geregelt und wird als vorvertragliche Anzeigepflicht bezeichnet. Sie besteht unabhängig davon, ob die Fragen im Antrag sehr detailliert gestellt sind oder eher allgemein formuliert werden. Maßgeblich ist stets, dass jede gefragte Information richtig, präzise und vollständig erteilt wird. Unterlässt der Antragsteller Angaben oder macht er unrichtige Angaben, auch wenn dies nur aus Unachtsamkeit geschieht, kann dies gravierende rechtliche und finanzielle Folgen haben.
Wird eine Pflichtverletzung festgestellt, stehen dem Versicherer verschiedene Rechte zu, abhängig davon, ob der Antragsteller vorsätzlich, grob fahrlässig oder nur leicht fahrlässig gehandelt hat. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall erlischt der Versicherungsschutz rückwirkend, als hätte er nie bestanden, und der Versicherer muss im Leistungsfall nicht zahlen. Bei arglistiger Täuschung, das heißt, wenn der Antragsteller bewusst falsche Angaben macht, um sich einen Vorteil zu verschaffen, kann der Versicherer den Vertrag auch noch Jahre später anfechten. Dies kann sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, etwa den Tatbestand des Versicherungsbetrugs. Selbst bei leicht fahrlässigen Falschangaben kann der Versicherer den Vertrag anpassen, beispielsweise durch höhere Beiträge oder den Ausschluss bestimmter Risiken.
Besonders bedeutsam ist, dass die meisten Gesundheitsfragen im Antrag sehr klar formuliert sind und oft auch Zeiträume umfassen, die mehrere Jahre zurückreichen. Hierzu gehören Fragen nach stationären Krankenhausaufenthalten, Operationen, chronischen Erkrankungen, psychischen Beschwerden oder regelmäßig eingenommenen Medikamenten. Der Versicherer geht davon aus, dass der Antragsteller seine eigene Krankengeschichte kennt und dass er, falls er sich unsicher ist, medizinische Unterlagen einsehen oder beim Arzt nachfragen kann. Auch scheinbar geringfügige oder längst abgeklungene Erkrankungen können aus Sicht des Versicherers relevant sein, weil sie Rückschlüsse auf das zukünftige Risiko erlauben.
Für den Antragsteller bedeutet dies, dass er sich vor dem Ausfüllen der Gesundheitsfragen sorgfältig vorbereiten sollte. Empfehlenswert ist, eine vollständige Übersicht über alle relevanten medizinischen Ereignisse der letzten Jahre zusammenzustellen, gegebenenfalls mit Unterstützung der behandelnden Ärzte. Ebenso sollte man keine Vermutungen anstellen oder Antworten „schönfärben“, um bessere Vertragskonditionen zu erhalten. Solche Vorgehensweisen mögen kurzfristig verlockend erscheinen, können aber langfristig zu erheblichen Nachteilen führen, insbesondere dann, wenn im Leistungsfall – also bei Eintritt des Versicherungsfalls – die Angaben überprüft werden. Versicherer haben in der Regel das Recht, bei einem Leistungsantrag Einsicht in ärztliche Unterlagen zu nehmen, Befunde abzufragen und die Krankengeschichte zu rekonstruieren. Werden dabei Abweichungen zu den ursprünglichen Angaben festgestellt, droht nicht nur der Verlust der Leistung, sondern unter Umständen auch die vollständige Beendigung des Vertrags.
Die Pflicht zur vollständigen und richtigen Beantwortung von Gesundheitsfragen dient nicht nur dem Interesse des Versicherers, sondern auch dem Schutz der Versichertengemeinschaft. Versicherungsmodelle beruhen auf dem Solidarprinzip: Alle Versicherten zahlen Beiträge in einen gemeinsamen Topf, aus dem die Leistungen für die Versicherten im Schaden- oder Leistungsfall finanziert werden. Wenn einzelne Versicherte falsche Angaben machen, um trotz erhöhter Risiken zu günstigen Bedingungen aufgenommen zu werden, führt dies zu einer ungerechten Belastung der Gemeinschaft und kann die Kalkulation der Prämien insgesamt beeinträchtigen. Deshalb ist die korrekte Beantwortung der Gesundheitsfragen auch ein Beitrag zur Fairness und Stabilität des Versicherungssystems.
Darüber hinaus schützt die Ehrlichkeit des Antragstellers vor unangenehmen Überraschungen in der Zukunft. Wer seine Angaben korrekt macht, kann sich darauf verlassen, dass der Versicherungsschutz im Ernstfall Bestand hat. Dies gibt Sicherheit und vermeidet Streitigkeiten, die im Leistungsfall oft nicht nur finanziell, sondern auch psychisch belastend sind. Der Leistungsfall tritt häufig in einer ohnehin schwierigen Lebenssituation ein, zum Beispiel bei Krankheit, Unfall oder Berufsunfähigkeit. In solchen Momenten möchte man sich auf die Unterstützung des Versicherers verlassen können und nicht mit zusätzlichen rechtlichen Auseinandersetzungen konfrontiert werden.
Aus diesen Gründen sollte jeder Antragsteller die Beantwortung der Gesundheitsfragen mit derselben Sorgfalt behandeln wie einen Vertrag, der erhebliche finanzielle Bedeutung für ihn hat. Ein Versicherungsvertrag ist ein rechtlich verbindliches Geschäft, das auf dem Prinzip von Treu und Glauben beruht. Dazu gehört, dass beide Vertragsparteien ihre Pflichten erfüllen – der Versicherer durch transparente Vertragsgestaltung und die Übernahme des vereinbarten Risikos, der Versicherungsnehmer durch vollständige und richtige Angaben. Wer sich daran hält, schafft die Grundlage für ein stabiles und vertrauensvolles Vertragsverhältnis und sichert sich einen verlässlichen Versicherungsschutz, der im Bedarfsfall ohne Einschränkungen greift
WARUM VERLANGEN BESTIMMTE VERSICHERUNGEN IM ANTRAG ÜBERHAUPT GESUNDHEITSFRAGEN UND ANDERE NICHT?
Versicherungsunternehmen erheben in vielen Fällen Gesundheitsfragen im Antrag, weil sie eine Risikoprüfung durchführen müssen, bevor sie eine Police ausstellen. Diese Risikoprüfung ist ein zentraler Bestandteil der Versicherungswirtschaft, da sie es dem Versicherer ermöglicht, einzuschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Versicherungsfall eintritt, und wie hoch die damit verbundenen Kosten sein könnten. Vor allem in der Personenversicherung, wie etwa bei Lebens-, Berufsunfähigkeits- oder privaten Krankenversicherungen, spielen Gesundheitsdaten eine entscheidende Rolle. Der Versicherer muss beurteilen, ob der Antragsteller bereits Vorerkrankungen hat, ob bestimmte gesundheitliche Risiken bestehen oder ob der allgemeine Gesundheitszustand so beschaffen ist, dass er ein überdurchschnittlich hohes Schadenrisiko darstellt. Ohne diese Einschätzung könnten die Versicherer nicht zwischen verschiedenen Risikoprofilen unterscheiden, was dazu führen würde, dass alle Versicherten unabhängig vom tatsächlichen Risiko denselben Beitrag zahlen müssten. Dies würde in der Praxis bedeuten, dass gesunde Personen die Kosten derjenigen mit hohem Risiko mittragen, was zu einer massiven Beitragssteigerung für alle führen könnte und die Versicherung für viele unattraktiv machen würde. Der Hintergrund liegt also in dem Grundprinzip der versicherungstechnischen Kalkulation: Beiträge sollen fair und risikogerecht sein. Versicherungen, die Gesundheitsfragen stellen, möchten genau diese Differenzierung erreichen, um für jede versicherte Person einen angemessenen Beitrag festlegen zu können, der das individuelle Risiko widerspiegelt. Dabei gilt, dass je höher das Risiko eines Versicherungsfalls ist, desto höher fällt auch der zu zahlende Beitrag aus oder es kommt sogar zu einem Ausschluss bestimmter Leistungen oder Erkrankungen.
Es gibt jedoch auch Versicherungen, die keine Gesundheitsfragen stellen. Dies findet man häufig bei sogenannten vereinfachten Annahmeverfahren, Gruppenversicherungen oder Produkten, die ohne individuelle Risikoprüfung auskommen. Der Grund hierfür liegt in einer anderen Kalkulationsbasis. Bei Kollektivverträgen, zum Beispiel über einen Arbeitgeber, eine Gewerkschaft oder einen Verband, verteilt sich das Risiko auf eine große Zahl von Versicherten. Der Versicherer geht davon aus, dass sich im Durchschnitt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gesunden und weniger gesunden Teilnehmern ergibt. Dadurch kann er auf eine individuelle Gesundheitsprüfung verzichten, ohne dass die Kalkulation ins Ungleichgewicht gerät. Ebenso gibt es Produkte, die aus sozialen oder strategischen Gründen ohne Gesundheitsfragen angeboten werden, etwa um Personen mit Vorerkrankungen einen Zugang zu einer Grundabsicherung zu ermöglichen. In diesen Fällen ist der Beitrag jedoch in der Regel höher oder die versicherte Leistung begrenzt, um das erhöhte Risiko auszugleichen.
Bei der Entscheidung, ob Gesundheitsfragen gestellt werden, spielen auch rechtliche und wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) schreibt vor, dass der Versicherungsnehmer vor Vertragsabschluss alle gefahrerheblichen Umstände wahrheitsgemäß anzugeben hat, wenn der Versicherer danach fragt. Werden keine Gesundheitsfragen gestellt, entfällt diese Pflicht zur Offenbarung, und der Versicherer kann sich später nicht auf vorvertragliche Anzeigepflichtverletzungen berufen. Das kann für Kunden von Vorteil sein, schränkt aber gleichzeitig die Möglichkeiten des Versicherers ein, sich gegen hohe Risiken abzusichern. In Fällen ohne Gesundheitsfragen kalkuliert der Versicherer daher von vornherein mit einem Sicherheitszuschlag, der potenzielle Mehrkosten abfedern soll.
Es gibt zudem einen Unterschied zwischen Risikolebensversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Leistungsfalls stark vom Gesundheitszustand abhängt, und Sach- oder Haftpflichtversicherungen, bei denen gesundheitliche Faktoren keine Rolle spielen. Letztere kommen gänzlich ohne Gesundheitsprüfung aus, da die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens nicht von der Gesundheit der versicherten Person beeinflusst wird. Auch bei kleinen Versicherungssummen oder kurzlaufenden Verträgen entscheiden sich manche Anbieter bewusst gegen Gesundheitsfragen, weil die wirtschaftliche Bedeutung eines möglichen Leistungsfalls für das Unternehmen gering ist und der Verwaltungsaufwand einer Risikoprüfung den potenziellen Nutzen übersteigen würde.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gesundheitsfragen im Antrag vor allem aus versicherungstechnischen Gründen gestellt werden, um eine faire, risikogerechte und wirtschaftlich tragfähige Beitragsgestaltung zu ermöglichen. Sie schützen sowohl die Versichertengemeinschaft vor einer Überbelastung durch hohe Schadenkosten als auch den Versicherer vor unkalkulierbaren Risiken. Versicherungen ohne Gesundheitsfragen beruhen dagegen meist auf einer kollektiven Risikoverteilung, höheren Beiträgen, Leistungseinschränkungen oder strategischen Marktüberlegungen. Beide Modelle haben ihre Berechtigung, unterscheiden sich aber deutlich in ihrer Kalkulationsgrundlage und Zielgruppe. Wer sich für eine Versicherung entscheidet, sollte deshalb genau prüfen, welche Variante angeboten wird und welche Konsequenzen dies für Beitragshöhe, Leistungsumfang und spätere Absicherung bedeutet.
WIE UNTERSCHEIDEN SICH DIE GESUNDHEITSFRAGEN ZUM BEISPIEL ZWISCHEN EINER PRIVATEN KRANKENVERSICHERUNG, RISIKOTODESFALLVERSICHERUNG, BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG ODER EINER UNFALLVERSICHERUNG?
Gesundheitsfragen stellen einen entscheidenden Bestandteil bei der Antragsprüfung vieler Versicherungen dar. Sie dienen dem Versicherer dazu, das individuelle Risiko des Antragstellers einzuschätzen und auf dieser Grundlage über die Annahme des Antrags sowie über die Höhe des Beitrags und mögliche Leistungsausschlüsse zu entscheiden. Je nach Versicherungsart unterscheiden sich sowohl der Umfang als auch die inhaltliche Tiefe der Gesundheitsfragen teils erheblich, weil jede Versicherungsart auf unterschiedliche Risiken abzielt und dementsprechend andere medizinische und persönliche Informationen benötigt werden.
Bei einer privaten Krankenversicherung (PKV) sind die Gesundheitsfragen besonders detailliert und weitreichend. Der Grund dafür liegt darin, dass die PKV nicht wie die gesetzliche Krankenversicherung ein Solidarprinzip mit einheitlichen Beiträgen kennt, sondern Beiträge individuell nach dem Gesundheitszustand, Alter, Geschlecht und gewünschtem Leistungsumfang kalkuliert. Die Gesundheitsprüfung umfasst meist einen längeren Abfragezeitraum, oft fünf bis zehn Jahre, bei bestimmten Krankheitsbildern sogar länger. Gefragt wird unter anderem nach stationären und ambulanten Behandlungen, chronischen Erkrankungen, regelmäßiger Medikamenteneinnahme, Operationen, psychischen Erkrankungen, Therapien, Rehabilitationsmaßnahmen und ärztlichen Beratungen. Auch frühere Diagnosen, die aktuell vielleicht keine Beschwerden verursachen, müssen angegeben werden, da sie für das zukünftige Kostenrisiko relevant sein können. Selbst vergleichsweise harmlose Befunde oder abklärende Untersuchungen werden häufig abgefragt, um ein möglichst vollständiges Risikoprofil zu erhalten.
In der Risikolebensversicherung, die ausschließlich auf die Absicherung des Todesfallrisikos abzielt, sind die Gesundheitsfragen in der Regel weniger umfangreich als bei einer PKV, aber dennoch genau auf das Mortalitätsrisiko ausgerichtet. Der Versicherer interessiert sich vor allem für Erkrankungen oder Lebensumstände, die die Lebenserwartung verkürzen können. Dazu gehören beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebsdiagnosen, schwere Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, psychische Leiden mit erhöhter Suizidgefahr, HIV-Infektionen oder riskante Freizeitaktivitäten und Berufe. Der Abfragezeitraum ist oft kürzer als in der PKV, liegt aber bei relevanten Vorerkrankungen dennoch meist bei fünf bis zehn Jahren. Auch Körpergröße, Gewicht, Rauchgewohnheiten und Alkoholkonsum werden erfasst, da sie signifikanten Einfluss auf das Sterblichkeitsrisiko haben.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) prüft das Risiko, dass der Versicherte aufgrund von Krankheit, Unfall oder Kräfteverfall dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben. Entsprechend breit gefächert sind die Gesundheitsfragen, da nicht nur lebensbedrohliche, sondern auch arbeitsrelevante Erkrankungen und Beschwerden eine Rolle spielen. Abgefragt werden beispielsweise orthopädische Probleme wie Bandscheibenvorfälle, Gelenkbeschwerden oder chronische Rückenprobleme, psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Burnout, neurologische Erkrankungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Sehstörungen, Hörschäden und viele weitere Leiden, die zu einer Berufsunfähigkeit führen können. Der Abfragezeitraum liegt in der Regel bei fünf bis zehn Jahren, wobei manche Fragen gezielt kürzere Zeiträume abdecken, etwa bei psychischen Beschwerden oder Krankenhausaufenthalten. In vielen Fällen werden auch Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand, zu bestehenden Behandlungen oder zu geplanten medizinischen Eingriffen gestellt.
Bei der Unfallversicherung schließlich fallen die Gesundheitsfragen deutlich kürzer und eingeschränkter aus als bei den zuvor genannten Versicherungsarten, da diese Versicherung ausschließlich für die finanziellen Folgen von Unfällen aufkommt und nicht für Krankheiten. In vielen Fällen genügt eine stark vereinfachte Gesundheitsprüfung oder es werden nur einzelne Risikofaktoren abgefragt, wie etwa bestehende Behinderungen, chronische Erkrankungen, die Unfallfolgen verschlimmern könnten, oder gravierende körperliche Einschränkungen. Der Grund für diese zurückhaltende Abfrage liegt darin, dass Krankheiten bei der Leistungspflicht nur eine untergeordnete Rolle spielen und die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Unfalls nur bedingt vorhersehbar ist. Dennoch behalten sich manche Versicherer vor, bei erkennbar erhöhtem Risiko, etwa aufgrund bestimmter Erkrankungen oder riskanter Freizeitbeschäftigungen, zusätzliche Fragen zu stellen oder Zuschläge und Ausschlüsse zu vereinbaren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tiefe und Detailgenauigkeit der Gesundheitsfragen stark davon abhängen, welches Risiko die Versicherung abdeckt und wie sehr der aktuelle oder vergangene Gesundheitszustand dieses Risiko beeinflusst. Während die private Krankenversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung sehr umfassende Gesundheitsprüfungen vornehmen, um ein möglichst vollständiges Bild zu gewinnen, sind die Fragen in der Risikolebensversicherung auf lebensverkürzende Faktoren fokussiert und in der Unfallversicherung oft deutlich reduziert. Die korrekte und vollständige Beantwortung dieser Fragen ist in allen Fällen von höchster Bedeutung, da falsche oder unvollständige Angaben zu erheblichen Nachteilen bis hin zum Verlust des Versicherungsschutzes führen können. Wer sich im Vorfeld unsicher ist, sollte daher vor Antragstellung relevante medizinische Unterlagen einsehen, gegebenenfalls eine Selbstauskunft beim behandelnden Arzt anfordern und im Zweifel fachkundigen Rat einholen, um Missverständnisse oder ungewollte Obliegenheitsverletzungen zu vermeiden.
LEISTUNGSFALL OHNE ÄRGER: MIT DIESEN ANGABEN GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER!
Wenn Sie einen Versicherungs- oder Versorgungsantrag stellen, sind die Angaben zu Ihrem Gesundheitszustand von zentraler Bedeutung. Sie bilden die Grundlage für die Entscheidung des Versicherers, ob und zu welchen Bedingungen der Vertrag zustande kommt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie persönlich bestimmte Erkrankungen oder Beschwerden für unwichtig halten – entscheidend ist, dass die Gesundheitsfragen vollständig, präzise und wahrheitsgemäß beantwortet werden. Die Fragen sind so formuliert, dass sie auch Sachverhalte erfassen, die für Sie vielleicht nebensächlich erscheinen, für die Risikobewertung jedoch von großer Bedeutung sein können. Ein fremder Risikoprüfer, der Sie nicht persönlich kennt, muss anhand Ihrer Antworten in der Lage sein, ein objektives und vollständiges Bild Ihres Gesundheitszustandes zu gewinnen. Je klarer, lückenloser und nachvollziehbarer Ihre Angaben sind, desto geringer ist das Risiko von Missverständnissen oder späteren Streitigkeiten.
Um dies zu erreichen, sollten Sie vor der Beantwortung der Fragen Ihre persönlichen medizinischen Unterlagen systematisch zusammentragen. Dazu gehören Arztberichte, Krankenhausentlassungsbriefe, Untersuchungsergebnisse, Medikamentenlisten und gegebenenfalls Dokumentationen von Krankenkassen oder Physiotherapeuten. Auch wenn Sie sich aktuell gesund fühlen, sind frühere Erkrankungen, Untersuchungen oder Behandlungen oft anzugeben – selbst dann, wenn sie vollständig ausgeheilt sind oder ohne Befund blieben. Bei zeitlich begrenzten Rückfragen, zum Beispiel zu den letzten fünf oder zehn Jahren, ist es wichtig, den gefragten Zeitraum exakt einzuhalten. Vergessen Sie nicht, dass auch abgebrochene Therapien oder ärztlich empfohlene, aber nicht umgesetzte Behandlungen relevant sein können, wenn die Fragen darauf abzielen.
Versuchen Sie, medizinische Begriffe korrekt wiederzugeben, und beschreiben Sie Beschwerden so, dass ein unbeteiligter Dritter den Sachverhalt nachvollziehen kann. Bei chronischen Erkrankungen ist es hilfreich, den Verlauf kurz darzustellen, etwa Beginn, Art der Behandlung, aktueller Zustand und Prognose. Wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Umstand anzugeben ist, sollten Sie ihn eher erwähnen. Es ist besser, eine möglicherweise überflüssige Angabe zu machen, als einen relevanten Sachverhalt zu verschweigen, der später zum Problem werden kann. Eine unvollständige oder falsche Beantwortung kann je nach Schwere von bloßen Beitragserhöhungen bis hin zur Anfechtung des Vertrages führen. In gravierenden Fällen droht sogar der vollständige Verlust des Versicherungsschutzes, und bei Vorsatz kann ein strafrechtlicher Tatbestand wie Betrug erfüllt sein.
Rechtlich gesehen sind Sie gemäß den §§ 19 ff. Versicherungsvertragsgesetz verpflichtet, alle gefragten Informationen wahrheitsgemäß zu offenbaren. Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob Sie von der Relevanz überzeugt sind. Wenn Sie beispielsweise vor einigen Jahren eine Untersuchung hatten, die ohne Diagnose endete, und diese im abgefragten Zeitraum liegt, muss sie angegeben werden, wenn die Frage danach verlangt. Gleiches gilt für vorübergehende Beschwerden, Arztbesuche wegen Abklärung, verschriebene Medikamente, psychotherapeutische Sitzungen, operative Eingriffe, auch wenn sie minimal waren, und stationäre Aufenthalte, selbst wenn diese nur zur Beobachtung dienten. Der Versicherer ist nicht verpflichtet, Ihre Angaben zu hinterfragen oder zu recherchieren – er darf sich darauf verlassen, dass Sie vollständig und richtig antworten.
Ein fremder Risikoprüfer, der später Ihren Antrag prüft, kennt Ihre persönliche Situation nicht. Er sieht lediglich Ihre schriftlichen Angaben und vergleicht diese mit objektiven medizinischen Standards und statistischen Risikoprofilen. Deshalb ist es entscheidend, dass Ihre Antworten nicht lückenhaft, verkürzt oder missverständlich sind. Schreiben Sie nicht nur - Rückenschmerzen 2019 -, sondern erläutern Sie kurz den Grund, die Diagnose, die Dauer, ob und wie behandelt wurde und ob die Beschwerden vollständig abgeklungen sind. So verhindern Sie, dass der Prüfer zusätzliche Rückfragen stellt oder im schlimmsten Fall annimmt, es könne sich um eine schwerwiegendere Erkrankung handeln.
Es ist ratsam, die Beantwortung der Gesundheitsfragen nicht unter Zeitdruck vorzunehmen. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um sorgfältig jede einzelne Frage zu lesen, zu verstehen und zu beantworten. Prüfen Sie abschließend, ob Sie alle Zeiträume vollständig erfasst haben und ob Ihre Angaben durch Unterlagen belegt werden können. Wenn Sie medizinische Fachbegriffe nicht kennen oder unsicher sind, wie eine Diagnose korrekt heißt, fragen Sie Ihren Arzt oder lassen Sie sich Auszüge aus Ihrer Patientenakte geben. So vermeiden Sie unklare Formulierungen, die später zu Auslegungsproblemen führen könnten.
Wer diesen Prozess ernst nimmt und systematisch vorgeht, schützt sich vor erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken. Denn nur wenn ein Versicherer die vollständige Wahrheit kennt, kann er eine faire und belastbare Entscheidung über den Vertrag treffen. Im Leistungsfall – etwa bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Invalidität – sind unklare oder falsche Angaben oft der Grund, warum Leistungen verweigert werden. Wer von Beginn an vollständige, verständliche und überprüfbare Angaben macht, legt nicht nur die Basis für einen wirksamen Versicherungsschutz, sondern erspart sich auch langwierige und belastende Auseinandersetzungen mit dem Versicherer. Damit schaffen Sie die Grundlage für eine reibungslose Prüfung und einen Vertrag, der im Ernstfall tatsächlich die Sicherheit bietet, für die er gedacht ist.
Es besteht die Möglichkeit, eine Abfrage seiner Krankheitsdiagnosen von der gesetzlichen Krankenversicherung anzufordern. Hier sind oft nur kurze Informationen über die Diagnosen und die Behandler enthalten. Dann können Sie direkt bei den Behandlern die jeweiligen Informationen anfordern.
WAS PASSIERT, WENN ICH BEI ANTRAGSTELLUNG DIE GESUNDHEITSFRAGEN NICHT WAHRHEITSGEMÄß ODER UNVOLLSTÄNDIG BEANTWORTE?
Wenn bei einem Versicherungs- oder Versorgungsantrag Gesundheitsfragen nicht wahrheitsgemäß oder unvollständig beantwortet werden, kann dies erhebliche rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen, die oft weitreichender sind, als Antragsteller zunächst vermuten. Die Gesundheitsfragen dienen Versicherungsunternehmen und Versorgungsträgern dazu, das individuelle Risiko einzuschätzen und die Entscheidung zu treffen, ob, zu welchen Bedingungen und mit welchen Beiträgen der Vertrag zustande kommt. Grundlage für diese Risikoprüfung ist die Pflicht des Antragstellers, alle gestellten Fragen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Maßgeblich ist dabei nicht, ob der Antragsteller eine Erkrankung selbst für relevant hält, sondern ob die Frage darauf abzielt, Informationen zu genau diesem Sachverhalt zu erlangen. Schon das bewusste Weglassen einzelner Details, die in der Frage klar abgefragt werden, kann als arglistige Täuschung gewertet werden. Auch fahrlässige Falschangaben, also Angaben, die aufgrund mangelnder Sorgfalt unzutreffend sind, können rechtliche Folgen haben, wenn sie objektiv erheblich für die Risikoeinschätzung gewesen wären.
Rechtlich ist diese Pflicht zur wahrheitsgemäßen Beantwortung in Deutschland in den §§ 19 ff. des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) geregelt. Wer eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, muss mit verschiedenen Reaktionen des Versicherers rechnen. Diese reichen von einer nachträglichen Vertragsanpassung, etwa in Form von Leistungsausschlüssen oder höheren Beiträgen, bis hin zur vollständigen Anfechtung oder Kündigung des Vertrages. Bei einer Anfechtung wegen arglistiger Täuschung wird der Vertrag rückwirkend so behandelt, als hätte er nie bestanden. Das bedeutet, dass im Leistungsfall keine Auszahlung erfolgt und bereits gezahlte Leistungen möglicherweise zurückgefordert werden. Im Falle einer Kündigung endet der Vertrag für die Zukunft, und der Versicherungsschutz entfällt ab diesem Zeitpunkt. Je nach Verschuldensgrad – ob fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt wurde – unterscheiden sich die Handlungsmöglichkeiten des Versicherers. Selbst wenn der Antragsteller nicht in böser Absicht gehandelt hat, kann eine unvollständige oder falsche Beantwortung dazu führen, dass im Leistungsfall die Ansprüche ganz oder teilweise entfallen.
Besonders gravierend sind die Folgen, wenn ein Versicherungsfall eintritt und der Versicherer bei der Leistungsprüfung feststellt, dass Angaben im Antrag nicht korrekt waren. In solchen Situationen prüfen Versicherer genau, ob sie sich von der Leistungspflicht befreien können. Wenn die unrichtigen Angaben in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Versicherungsfall stehen, ist es für den Versicherer in der Regel leichter, sich auf Leistungsfreiheit zu berufen. Aber auch wenn kein direkter Zusammenhang besteht, kann je nach rechtlicher Ausgangslage eine Anfechtung oder Vertragsanpassung möglich sein. Die Beweislast, dass die Angaben falsch oder unvollständig waren, liegt grundsätzlich beim Versicherer. Allerdings ist es oft leicht nachzuweisen, wenn Arztunterlagen, Krankenkassenauskünfte oder andere Dokumente gegenteilige Informationen enthalten. Für den Versicherten kann das nicht nur den Verlust des Versicherungsschutzes bedeuten, sondern auch rechtliche und wirtschaftliche Nachteile wie das Fehlen einer Absicherung in einer ohnehin schwierigen Lebenssituation.
Für viele Antragsteller ist es wichtig zu verstehen, dass es bei Gesundheitsfragen nicht nur um akute Erkrankungen geht, sondern auch um zurückliegende Beschwerden, ärztliche Untersuchungen, Therapien, Krankenhausaufenthalte oder sogar diagnostische Abklärungen, selbst wenn diese ohne Befund blieben. Was subjektiv als „Bagatelle“ empfunden wird, kann aus Sicht des Versicherers ein erheblicher Risikofaktor sein. Die vollständige und präzise Beantwortung solcher Fragen ist daher entscheidend. Sollte ein Antragsteller unsicher sein, ob eine Information anzugeben ist, empfiehlt es sich, die Angabe vorsorglich zu machen oder Rücksprache mit dem Versicherer oder Vermittler zu halten. Zudem ist es ratsam, vor Antragstellung alle relevanten medizinischen Unterlagen zusammenzutragen, um keine Erinnerungslücken zu haben, die später zu Problemen führen könnten. Eine präzise und vollständige Beantwortung schützt nicht nur vor späteren rechtlichen Auseinandersetzungen, sondern auch vor dem Risiko, im Ernstfall ohne Schutz dazustehen.
Im Zusammenhang mit betrieblichen Versorgungssystemen, etwa einer Direktversicherung oder Unterstützungskasse, gilt das Gesagte gleichermaßen. Auch hier können fehlerhafte Gesundheitsangaben gravierende Auswirkungen haben. Da in solchen Fällen nicht nur der einzelne Versicherungsvertrag, sondern auch arbeitsrechtliche und steuerliche Aspekte betroffen sein können, ist die Rechtslage oft noch komplexer. Wird der Versicherungsschutz aufgrund falscher Angaben rückwirkend aufgehoben, kann dies auch den Arbeitgeber in Schwierigkeiten bringen, insbesondere wenn zugesagte Versorgungsleistungen nicht mehr abgesichert sind. Deshalb ist sowohl aus Sicht des Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers größte Sorgfalt bei der Antragstellung geboten. In bestimmten Fällen kann sich bei vorsätzlichen Falschangaben sogar ein strafrechtlicher Vorwurf, etwa des Betruges, ergeben. Das verdeutlicht, dass es sich nicht nur um eine formale Pflicht handelt, sondern um eine rechtlich bindende und mitunter haftungsträchtige Verantwortung.
WIE FÜLLE ICH DIE GESUNDHEITSFRAGEN RICHTIG IM VERSICHERUNGSANTRAG AUS?
Wenn Sie bei einem Antrag auf eine Versicherung oder betriebliche Altersversorgung Gesundheitsfragen gestellt bekommen, sind diese nicht einfach nur Formulare zum Abhaken. Sie sind ein entscheidender Teil der sogenannten Risikoprüfung, mit der der Versicherer feststellt, ob und unter welchen Bedingungen er Ihnen Schutz gewährt.
Wer diese Fragen nur mit einem knappen -Ja- oder -Nein- beantwortet, ohne die geforderten Einzelheiten anzugeben, läuft Gefahr, ungewollt eine Pflichtverletzung zu begehen – selbst dann, wenn keine böse Absicht dahintersteckt.
Die rechtliche Grundlage dafür ist die sogenannte vorvertragliche Anzeigepflicht nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Danach müssen alle Angaben vollständig, wahrheitsgemäß und so genau wie möglich gemacht werden, wenn der Versicherer ausdrücklich danach fragt.
Stellen Sie sich vor, die Gesundheitsfrage lautet:
-
Hatten Sie in den letzten fünf Jahren Erkrankungen, Beschwerden oder Behandlungen?
Wenn Sie nur -Ja- ankreuzen, ohne zu erklären, welche Erkrankung es war, wann sie auftrat, wie sie behandelt wurde und ob Sie wieder gesund sind, fehlt dem Versicherer ein Großteil der entscheidenden Informationen. -
Das ist so, als würde ein Arzt fragen: Wo haben Sie Schmerzen?
und Sie würden nur -Ja- antworten
Er könnte keine richtige Diagnose stellen. Genau so kann der Versicherer das Risiko nicht korrekt einschätzen. Sie sagen dem Arzt auch: Ich habe im rechten Knie oder im unteren Bereich der Wirbelsäule schmerzen oder Beschwerden, wenn ich mich bewege oder aufstehe. -
Er darf davon ausgehen, dass Sie die Frage vollständig beantworten, und das bedeutet:
alle relevanten Details nennen. Dazu gehören Art der Erkrankung, Dauer, Behandlung, ärztliche Befunde und ob Sie wieder beschwerdefrei sind. -
Warum ist das so wichtig?
Wenn Sie später Leistungen beantragen – etwa bei einer Berufsunfähigkeit oder im Todesfall für die Hinterbliebenen –, prüft der Versicherer, ob Sie damals alle Gesundheitsfragen korrekt beantwortet haben. -
Findet der Versicherer im Leistungsfall heraus, dass Sie zwar -Ja- gesagt, aber entscheidende Angaben weggelassen haben,
kann er den Vertrag kündigen, anfechten oder die Leistung verweigern. -
Bei einer arglistigen Täuschung, also wenn bewusst falsche oder unvollständige Angaben gemacht wurden,
kann der Vertrag sogar rückwirkend aufgehoben werden. -
Das bedeutet:
Es gibt keine Auszahlung, und bereits gezahlte Leistungen könnten zurückgefordert werden. Auch ohne böse Absicht kann eine unvollständige Antwort dazu führen, dass Sie im Leistungsfall leer ausgehen, wenn der Versicherer beweisen kann, dass er den Vertrag so nicht oder nur zu anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
Für Laien ist oft nicht klar, dass der Versicherer nicht selbst errät, welche Zusatzinformationen er braucht. Er verlässt sich darauf, dass der Antragsteller alles von sich aus angibt, was die Frage verlangt. Selbst wenn Sie meinen, eine frühere Krankheit sei längst ausgestanden oder unwichtig, könnte sie für die Risikobewertung relevant sein.
- Das gilt auch für Diagnosen, die nur vorsorglich gestellt wurden oder für Symptome, die inzwischen abgeklungen sind. Alles, was in den Gesundheitsfragen ausdrücklich erfragt wird, muss daher präzise angegeben werden – nicht nur ein Haken bei -Ja- oder -Nein-.
Die Folgen eines knappen, unvollständigen Kreuzchens können nicht nur Ihren eigenen Schutz gefährden, sondern auch rechtliche Probleme verursachen. Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung etwa kann der Wegfall des Versicherungsschutzes dazu führen, dass ein Arbeitgeber seine Versorgungszusage nicht erfüllen kann, was arbeitsrechtliche und steuerliche Konsequenzen nach sich zieht. In besonders schweren Fällen – etwa bei bewusstem Verschweigen – kann sogar der Straftatbestand des Betrugs erfüllt sein.
Das ist kein theoretisches Risiko: Gerichte entscheiden immer wieder zugunsten des Versicherers, wenn klar ist, dass Gesundheitsfragen nicht vollständig beantwortet wurden.
Kurz gesagt: Eine knappe Antwort mit -Ja- oder -Nein- mag schnell gehen, ist aber gefährlich. Jede Gesundheitsfrage ist so zu beantworten, dass der Versicherer die Situation vollständig nachvollziehen kann. Wer sich unsicher ist, ob eine Angabe erforderlich ist, sollte sie lieber machen oder den Versicherer direkt um Klärung bitten. So schützen Sie nicht nur Ihren Versicherungsschutz, sondern auch sich selbst vor späteren, oft sehr unangenehmen rechtlichen und finanziellen Folgen.
WIE BEANTWORTE ICH DIE UNTERSCHIEDLICHEN GESUNDHEITSFRAGEN RECHTSKRÄFTIG UND AUSREICHEND TRANSPARENT, DAS SCHAUEN WIR UNS JETZT IM DETAIL AN!
Als erstes ist es unerlässlich, jede einzelne Gesundheitsfrage (Alle gefragten Punkte: z. B. Diagnosen, Operationen, Allergien, andere medizinische Vorfälle) genau und lückenlos angeben – das betrifft sowohl ambulante Behandlungen (meist 5 Jahre rückwirkend) als auch stationäre Aufenthalte oder Operationen (i. d. R. 10 Jahre rückwirkend)) sorgfältig und aufmerksam zu lesen. Formulierungen sind bewusst präzise gewählt, und es kommt nicht darauf an, wie Sie Ihre eigene gesundheitliche Situation einschätzen, sondern darauf, welche Informationen konkret abgefragt werden. Jede Frage ist so zu beantworten, wie sie gestellt wird – vollständig, wahrheitsgemäß und ohne Weglassen von Details, die im gefragten Zeitraum oder im gefragten Zusammenhang relevant sind.
WIE FÜHRE ICH AM BESTEN EINE OP AM RECHTEN BEIN AUF?
Beinbruch rechts, rechts Schienbein gebrochen durch Fahrradunfall, kein Fremdmaterial vorhanden, 5 Tage im Krankenhaus (KH: Schöner Ausblick, Sonnenstr. 1, 80333 München), Prof. Dr. M. Gruber. Keine anderen Beschwerden durch den Fahrradunfall. Anschließend noch 1 Woche krank zu Hause. Anschließend 10. Krankengymnastik bei MedSport, Fitstr. 21, 80333 München. Nachkontrolle bei Dr. Riedl, Burgerstr. 41, 80333 München ohne Befund, ausgeheilt, beschwerdefrei, nicht mehr behandlungsbedürftig. Zusätzlich legen Sie den Krankenhausentlassungsbericht bei. Es wurde für die Schmerzen Ibuprofen Tabletten verschieben (vgl. Angaben von Medikamenten: z.B. 2 mal pro Tag eine Tablette 2mg / 1 Woche).
WIE FÜHRE ICH AM BESTEN ARZNEIMITTEL ODER MEDIKAMENTE AUF?
Bei der Aufführung von Arzneimittel müssen immer folgende Angaben aufgeführt werden (Name des Medikamentes, welche Dosis wird eingenommen (z.B. mg) und die Häufigkeit (einmal, zweimal oder dreimal pro Tag), wie lange wird oder wurde das Medikament eingenommen und warum wird das Medikament für welche Diagnose eingenommen).
WIE FÜHRE ICH DAS THEMA RÜCKENBESCHWERDEN AUF?
Rückenbeschwerden gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen und werden in der Umgangssprache oft mit dem Begriff Bandscheibenvorfall oder Prolaps gleichgesetzt. Genau diese Beschwerden sind ein anschauliches Beispiel dafür, wie entscheidend eine präzise und vollständige Angabe in einem Versicherungsantrag mit Gesundheitsfragen ist. Der Grund liegt darin, dass viele Betroffene ihre anhaltenden Beschwerden, die sie selbst behandeln oder die sich im Alltag eingespielt haben, nicht als relevante Erkrankung einstufen – selbst, wenn sie irgendwann ärztlich festgestellt wurden. Diese Fehleinschätzung kann im Leistungsfall oder sogar schon bei der Antragsprüfung gravierende Folgen haben. Eine ungenaue oder verharmlosende Angabe kann dazu führen, dass der Versicherer den Antrag ablehnt, den Vertrag anpasst oder später die Leistung verweigert.
Ein Beispiel: Sie haben sich beim Umgraben im Garten verhoben, am nächsten Tag eine Spritze bei Ihrem Hausarzt erhalten und zur Vorbeugung noch zehn Einheiten Krankengymnastik verschrieben bekommen. Ihr Hausarzt, unter Zeitdruck und in der Regel mit knappen Ressourcen, trägt diesen Vorfall möglicherweise nicht als -einmalig eingeklemmten Nerv-, sondern als -Verdacht auf Bandscheibenvorfall- in Ihre Krankenakte ein.
Das kann Jahre später noch relevant werden, selbst wenn es Ihnen längst wieder gut geht.
In einem anderen Fall wurde tatsächlich ein Bandscheibenvorfall im Bereich L4/L5 diagnostiziert, der durch fünfzehn Sitzungen einer speziellen Therapie (X-MED) vollständig auskuriert wurde. Der Patient war anschließend beschwerdefrei und es bestand keine weitere Behandlungsnotwendigkeit. Wenn im Antrag jedoch lediglich das Wort -Prolaps- eingetragen wird, kann der Risikoprüfer nicht beurteilen, ob es sich um einen vollständig ausgeheilten Vorfall handelt oder ob ein akutes Risiko besteht, in naher Zukunft operiert werden zu müssen. In solchen Fällen sollte zusätzlich der Bericht der X-Med Therapie, die durch den jeweiligen Orthopäden begleitet wurde mit beigefügt werden.
Daher ist es zwingend erforderlich, im Antrag nicht nur die Diagnose, sondern auch den aktuellen Gesundheitszustand, den Behandlungszeitraum, die verordneten Medikamente, sämtliche durchgeführten oder empfohlenen Therapien sowie den Verlauf der Erkrankung detailliert anzugeben. Nur so kann der Risikoprüfer die Situation realistisch einschätzen und den Versicherungsschutz sachgerecht beurteilen.
Von besonderer Bedeutung ist auch, dass Sie wissen, welche Einträge Ihr Behandler in Ihrer Krankenakte vornimmt. Das gilt nicht nur für Ärzte, sondern auch für Heilpraktiker. In manchen Fällen wird aus Gründen der Abrechnungsvereinfachung eine Diagnose verwendet, die für Sie als Versicherungsnehmer nachteilig sein kann – beispielsweise die Angabe eines Erschöpfungssyndroms, obwohl dies aus Ihrer Sicht nicht zutrifft.
Zwar ist der Versicherer verpflichtet, Ihnen falsche Angaben konkret darzulegen, jedoch kann er im Rahmen der Schweigepflichtentbindung Ihre Krankenakte einsehen. In diesem Fall müssen Sie nachweisen, dass die aufgeführte Diagnose zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich nicht vorlag. Gelingt dieser Nachweis nicht, droht die vollständige oder teilweise Leistungsverweigerung. Deshalb ist es im eigenen Interesse, bereits bei Antragstellung auf eine vollständige, klare und medizinisch genaue Beschreibung Ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte zu achten.
MUSS ICH AUCH BEHANDLUNGEN IM AUSLAND MIT AUFFÜHREN?
Ja, alle Behandlungen, die Sie im Ausland erhalten haben, müssen im Rahmen der Gesundheitsfragen vollständig und wahrheitsgemäß angegeben werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Behandlung nur kurzzeitig war oder ob Sie die Behandlung selbst als unwesentlich einschätzen. Für den Versicherer ist entscheidend, dass er ein vollständiges Bild Ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte erhält, um das Risiko richtig einzuschätzen.
Auch wenn medizinische Dokumente oder Berichte aus dem Ausland schwerer zugänglich oder in einer anderen Sprache verfasst sind, entbindet Sie das nicht von der Pflicht zur Offenlegung. Es ist empfehlenswert, vorhandene Unterlagen ins Deutsche übersetzen zu lassen oder zumindest eine verständliche Zusammenfassung beizufügen. Unvollständige Angaben oder das Verschweigen von Auslandsbehandlungen können später dazu führen, dass der Versicherer im Leistungsfall Leistungen ganz oder teilweise verweigert oder den Vertrag anfechtet.
Die vollständige Offenlegung aller Behandlungen ist daher nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern dient auch Ihrem eigenen Schutz. Nur wenn der Versicherer von Anfang an alle relevanten Informationen erhält, kann er einen rechtssicheren Vertrag anbieten, der im Ernstfall die zugesagten Leistungen erbringt.
WIE FÜHRE ICH DAS THEMA ALLERGIEN AUF?
Bei der Angabe von Allergien im Versicherungsantrag ist es wichtig, alle bekannten Allergien vollständig und genau zu benennen, unabhängig davon, ob diese aktuell Beschwerden verursachen oder nicht. Das bedeutet, Sie sollten sowohl Allergien gegen Medikamente, Nahrungsmittel, Insektengifte als auch gegen Umweltstoffe wie Pollen oder Hausstaubmilben angeben.
Wann sind diese Allergien das erste Mal aufgetreten, welche Beschwerden haben diese hervorgerufen, welcher Behandler hat diese festgestellt, wie wurde gegen die Allergie vorgegangen, wurde eine Sensibilisierung veranlasst, gibt es einen Allergietest. Wie oft tritt diese Allergie auf, wann tritt diese auf. Auch frühere Allergien, die inzwischen ausgeheilt sind oder keine Beschwerden mehr verursachen, gehören in die Angaben, sofern die Frage nach Allergien allgemein oder für einen nicht bestimmten Zeitraum gestellt wird.
Darüber hinaus sollten Sie beschreiben, wie schwer die Reaktionen typischerweise sind und ob bereits medizinische Behandlungen wie Antihistaminika, Kortison oder Notfallmedikamente (zum Beispiel ein Adrenalin-Autoinjektor) notwendig waren. Auch regelmäßige Kontrolluntersuchungen oder vorbeugende Maßnahmen sind relevant. Wenn Sie sich unsicher sind, ob eine bestimmte Allergie angegeben werden muss, ist es immer ratsam, diese anzugeben.
Vollständige und ehrliche Angaben zu Allergien sind entscheidend, damit der Versicherer das Risiko realistisch bewerten kann. Werden Allergien verschwiegen oder unvollständig dargestellt, kann dies später im Leistungsfall zu Problemen führen, beispielsweise zu Leistungskürzungen oder sogar zur Anfechtung des Vertrags. Daher schützt eine sorgfältige und genaue Angabe nicht nur Ihre Rechte, sondern sorgt auch für Rechtssicherheit und Verlässlichkeit im Versicherungsschutz.
WIE FÜLLE ICH DIE GESUNDHEITSFRAGEN KORREKT AUS?
Alle gefragten Punkte (z. B. Diagnosen, Operationen, Allergien, andere medizinische Vorfälle) genau und lückenlos angeben – das betrifft sowohl ambulante Behandlungen (meist 5 Jahre rückwirkend) als auch stationäre Aufenthalte oder Operationen (i. d. R. 10 Jahre rückwirkend).
Angaben sollten sich exakt an den Wortlaut der gestellten Fragen halten: Nur danach explizit gefragte Diagnosen, Behandlungen oder Symptome müssen angegeben werden.
Auch vermeintliche Kleinigkeiten oder Arztbesuche bei Heilpraktikern und im Ausland sind anzugeben, falls die Frage dies verlangt; ebenso Verdachts- oder Ausschlussdiagnosen, wenn danach gefragt wird.
Immer die konkrete Diagnose, den Zeitraum, medizinische Maßnahmen und behandelnde Ärzte/Besuche auflisten. Pauschale oder ungenaue Angaben sind nicht ausreichend.
WIE WERDEN DIE ANGABEN IN DEN GESUNDHEITSFRAGEN RECHTSKRÄFTIG UND TRANSPARENT AUFGEFÜHRT?
Geben Sie für jede Diagnose/Vorkommnis (z. B. OP, Allergie) an.
Exakte medizinische Diagnose inklusive ICD-Code (wenn bekannt oder im Arztbericht vermerkt).
Datum/Zeitraum der Diagnose, Behandlung, Operation etc..
Therapien/Behandlungen und den Verlauf.
Angaben zum behandelnden Arzt/Krankenhaus.
Aktueller Status der Erkrankung (abgeschlossen, andauernd, Beschwerdefreiheit).
Keine Eigeninterpretationen oder Wertungen einfließen lassen; die Einschätzung übernimmt die Risikoprüfung des Versicherers.
WARUM IST OFT EIN GESUNDHEITSFRAGENBEIBLATT FÜR DIE BEANTWORTUNG DER GESUNDHEITSFRAGEN IM VERSICHERUNGSANTRAG EINE SINNVOLLE UND TRANSPARENT LÖSUNG?
Es gibt oft nicht genug Platz im Antragsformular, um komplexe Vorerkrankungen/Verläufe ausführlich und systematisch darzustellen. Ein Beiblatt bietet Raum, alle geforderten Details strukturiert und nachvollziehbar aufzuführen, damit Rückfragen vermieden werden. Um als rechtskräftige Antragsbeilage zu gelten, muss das Beiblatt eindeutig Bezug auf den Antrag nehmen (z. B. Name, Datum, Antragsnummer) und von Ihnen unterschrieben werden. Beim Versicherer muss dokumentiert werden, dass das Beiblatt Bestandteil des gestellten Antrags ist – am besten auch auf dem Hauptformular vermerken: -Siehe Beiblatt-, immer mit Unterschrift auf jedem Gesundheitsbeiblatt. Grundsätzlich sollten immer Versicherungsnehmer und versicherte Person dort unterschreiben.
WELCHE ANGABEN MÜSSEN AUF DEM GESUNDHEITSFRAGENBEIBLATT IMMER MIT AUFGEFÜHRT WERDEN?
Sämtliche im Antrag geforderten Daten lückenlos aufführen, orientiert an den offiziellen Fragen (Diagnose, Zeitraum, Maßnahmen, Ärzte, aktueller Status etc.). Eindeutige Zuordnung zum Antrag sicherstellen (z. B. Name, Geburtsdatum, Antragsnummer und die Nummer der Frage im Antrag). Eigenhändige Unterschrift (Versicherungsnehmer und versicherte Person)und möglichst auch Datum auf jedem Blatt des Beiblatts. Vollständige und nachvollziehbare Darstellung – es darf nichts nachträglich handschriftlich gestrichen oder hinzugefügt werden, ohne dass dies dokumentiert und gegengezeichnet ist.
Wichtiger Hinweis zum Gesundheitsbeiblatt im Versicherungsantrag:
Bewahren Sie Kopien Ihrer Angaben und des gesamten Antrags auf und lassen Sie sich ggf. von Ihrem Arzt oder den Krankenkassen Ihre Krankenakte zugänglich machen, damit keine wichtigen Diagnosen oder Behandlungen vergessen werden.
Fazit: Halten Sie sich immer exakt an die Antragsfragen und dokumentieren Sie alle geforderten Sachverhalte lückenlos, ungeschönt und nachvollziehbar. Nutzen Sie ein separates Gesundheitsbeiblatt, um Raum für ausführliche Angaben zu schaffen, achten Sie auf formale Punkte wie Unterschrift und Bezugnahme, und reichen Sie alle Unterlagen vollständig beim Versicherer. Liegen Ihnen Krankenhausentlassungsberichte, Laborbefunde, Allergiepass oder Arztberichte vor, müssen diese ebenfalls mit eingereicht werden, sofern diese zu den abgefragten Diagnosen oder aufgeführten Behandlungen in dem Zeitraum des Versicherungsantrages gehören.
Sie haben allgemeine Fragen zu den aufführen von Gesundheitsangaben, die mit dem gestellten Antrag bei unserem Hause zu tun haben, die bAVProfis stehen Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. Sind Sie kein Kunde unseres Hauses, kontaktieren Sie Ihren Berater oder das Versicherungsunternehmen, die helfen Ihnen gerne weiter. Bitte haben Sie Verständnis das wir in diesen zeitaufwendigen Themen nur unsere Kunden unterstützen können, da diese durch den Abschluss uns bezahlen.
Oder Sie schauen sich jetzt unser bAVTutorial: Gesundheitsfragen: So fülle ich präzise die Gesundheitsfragen im Versicherungsantrag aus von Felix an und seinem Team bereits im Tutorial beantwortet.
WEITERE FACHINFORMATIONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM THEMA:
LIEBER DAS FACHTHEMA UNTERWEGS ANHÖREN, HIER GEHT ES ZUM BAV-PODCAST:
SELBSTVERSTÄNDLICH STELLEN WIR AUCH TUTORIALS ÜBER DIE BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE ZUR VERFÜGUNG:
#bavprofis - Ihr Partner für die betriebliche Altersversorgung und der digitalen bAV Verwaltung und der vollständigen Kommunikation für alle Sinne des Menschen.
bAVProfis® - News rund um die betrieblichen Altersvorsorge by bAVProfis.