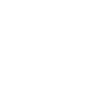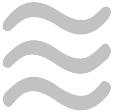OBERLANDESGERICHT HAMM | URTEIL | 04. APRIL 2025 | 20 U 33/21 | GERICHTE STÄRKEN VERBRAUCHER: BU-GESUNDHEITSFRAGEN SIND KEIN WUNSCHKONZERT FÜR VERSICHERER
VORSICHT, VERSICHERER: WER BU-ANTORTEN VERBIEGT, RISKIERT RECHTSBRUCH
OLG URTEIL | KEINE TRICKS ERLAUBT: BU-VERSICHERER DARF GESUNDHEITSFRAGEN NICHT NACH EIGENEM GUSTO DEUTEN

Urteil vom 04. APRIL, 20 U 33/21
Tenor:
Auf die Berufung des Klägers wird das am 05.01.2021 verkündete Urteil der 2. Zivilkammer des Landgerichts Detmold (2 O 2/18) – unter Zurückweisung der Berufung im Übrigen – teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 60.374,28 € zu zahlen nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 19.500,00 € seit dem 19.12.2014, aus weiteren 1.500,00 € seit dem ersten Tag eines jeden Monats für den Zeitraum von Januar 2015 bis einschließlich März 2017 sowie aus weiteren 374,28 € seit dem 12.01.2018.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte vom 01.04.2017 bis zum 31.12.2020 verpflichtet ist, dem Kläger bedingungsgemäße Leistungen wegen eingetretener Berufsunfähigkeit zu erbringen.
Es wird festgestellt, dass der Kläger im Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2020 von der Pflicht zur Zahlung der Beiträge für die genommene Berufsunfähigkeitsversicherung zur Versicherungsnummer N01 befreit gewesen ist.
Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von der Gebührenforderung der Rechtsanwälte N. für ihre außergerichtliche Tätigkeit in Höhe von 1.120,62 € freizustellen
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu zwei Dritteln und die Beklagten zu einem Drittel.
Dieses Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.
Die Partei, gegen die vollstreckt wird, kann eine Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des insgesamt zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die vollstreckende Partei vor einer Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
1 GRÜNDE:
I. Der Kläger macht Ansprüche aus einer ab dem 01.04.2010 bei der Beklagten genommenen Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Dynamik geltend.
Vereinbartes Versicherungsende ist der 31.03.2036. Die monatliche Rente beträgt 1.500,00 €; der monatliche Beitrag abzüglich Überschussbeteiligung beträgt 124,67 € (Versicherungsschein Blatt 23 der elektronischen Gerichtsakte erster Instanz, im Folgenden I-23 bzw. II- für die Akten der zweiten Instanz). Dem Versicherungsvertrag liegen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeitsversicherung (I-32 ff.; im Folgenden: AVB-BU) zugrunde. In § 1 AVB-BU wird die Berufsunfähigkeit wie folgt definiert„(1) Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % ihren zuletzt vor Eintritt dieses Zustands ausgeübten Beruf — so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestattet war — nicht mehr ausüben kann. Eine Verweisung auf eine andere Tätigkeit kommt nur dann in Betracht, wenn diese im Sinne von Absatz 4 a) konkret ausgeübt wird (Verzicht auf abstrakte Verweisung)
(…)
(3) Wird uns nachgewiesen, dass ein in Absatz 1 oder 2 beschriebener Zustand für einen Zeitraum von sechs Monaten ununterbrochen vorgelegen hat, gilt dieser Zustand von Beginn an als Berufsunfähigkeit
(4) a) Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt nicht vor, wenn die versicherte Person nach Eintritt des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen Zustands eine andere, ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten sowie ihrer bisherigen Lebensstellung entsprechende Tätigkeit ausübt und sie dazu auf Grund ihrer gesundheitlichen Verhältnisse zu mehr als 50 % in der Lage ist
Unter der bisherigen Lebensstellung ist die Lebensstellung in finanzieller und sozialer Sicht zu verstehen, die vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung gemäß Absatz 1 oder 2 bestanden hat. Die dabei für die versicherte Person zumutbare Einkommensreduzierung wird von uns je nach Lage des Einzelfalles auf die im Rahmen der höchstrichterlichen Rechtsprechung festgelegte Größe im Vergleich zum jährlichen Bruttoeinkommen im zuletzt ausgeübten Beruf, vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung, begrenzt.“
Dem Versicherungsvertrag liegt ein Antrag vom 06.03.2010 zugrunde (I-147 ff.), der vom Kläger und dem erstinstanzlich vernommenen Zeugen S. (nebst Stempel der Q.) unterschrieben (I-150) wurde. Über den Gesundheitsfragen findet sich in einem gelb hinterlegten, aber nicht umrandeten Kasten eine vollständig in Fettdruck gehaltene Belehrung über die Folgen falscher Angaben (I-148). In den Gesundheitsfragen heißt es u.a.:
„B4 Sind Sie in den letzten 5 Jahren untersucht, beraten oder behandelt worden hinsichtlich:12(…)
B4.2 Atmungsorgane (z. B. wiederholte oder chronische Bronchitis, Asthma)?
B4.8 Psyche (z. B. Depressionen, Angststörungen, Psychosen, psychosomatische Störungen)?15B4.9 Wirbelsäule, Sehnen, Bänder, Muskeln, Knochen oder Gelenke (z. B. Rückenerkrankungen, Arthrose, Rheuma)?
(…)“
Bei sämtlichen dieser Fragen ist „nein“ angekreuzt.
Unter D3 heißt es im Fragebogen:
„Wurden für Sie bereits Berufs-, Erwerbsunfähigkeits- oder Pflegerenten(-Zusatz)versicherungen bei anderen Lebensversicherungsunternehmen abgeschlossen oder sind solche Anträge in den letzten 5 Jahren – auch gleichzeitig mit diesem Antrag – gestellt worden (Angabe jährliche AVB-BU-/EU-/Pflegerente unter Erläuterungen)?“
Hierzu ist „ja“ angekreuzt und handschriftlich in dem hierfür vorgesehenen Feld angegeben worden:
„D3 Antrag bei B. gestellt im Juni 2009, Vertrag wurde widerrufen, kam somit nicht zustande.“
Tatsächlich hatte der Kläger einen Vertrag bei der B. Versicherung beantragt, der aber nach ärztlicher Stellungnahme nur mit einem Leistungsausschluss für Wirbelsäulenerkrankungen angenommen wurde. Unter Einschaltung des Zeugen S. widersprach der Kläger dem Zustandekommen dieses Vertrages (I-383). Weitere, vom jeweiligen Versicherer abgelehnte Anträge auf Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung stellte der Kläger bei der K. in 2006, bei der D. in 2007 und bei der W. in 2009 (I-451).
Der 1971 in A. geborene und zunächst auch dort aufgewachsene Kläger kam im Jahr 1982 nach Deutschland und erlangte die Mittlere Reife. Er schloss eine Ausbildung zum (..) erfolgreich ab und arbeitete zwei Jahre im erlernten Beruf, bis er wegen unattraktiver Arbeitszeiten und zur Erzielung höherer Einkünfte als Helfer in der Holzindustrie tätig wurde. Offenbar seit 2004 ist beim Kläger wegen einer Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und einer Nervenfunktionsstörung ein Grad der Behinderung von 30 anerkannt (II-159). Im Jahr 2004 wurde er auch (erstmalig) in der Klinik M. in Z. behandelt. Im April 2005 machte er sich mit einem Imbissbetrieb selbständig und verkaufte bis zum 31.08.2013 in einem Einkaufszentrum und einem davor aufgestellten Verkaufswagen Dönerspezialitäten und andere Speisen. Wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen und aus wirtschaftlichen Gründen (der hierzu divergierende Vortrag des Klägers zur Gewichtung der Ursachen ist streitig) gab er die Selbständigkeit auf und trat zum 01.09.2013 eine Tätigkeit in einem fleischverarbeitenden Betrieb an, der Dönerspieße herstellt. Ab dem 04.11.2013 (Gutachten V., I-79; in der Klageschrift ist der 13.11.2013 genannt, I-10) war der Kläger wegen Rückenschmerzen und psychischer Beeinträchtigungen krankgeschrieben. Die konkrete Ausgestaltung seiner Tätigkeiten und die Ausprägung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind streitig.24Die Behandlungen und Untersuchungen des Klägers im hier relevanten Zeitraum entwickelten sich wie folgt: Bereits im Jahr 2012 ließ sich der Kläger von R. psychiatrisch wegen Depressionen behandeln. Im November 2013 begab er sich wegen Rückenbeschwerden in orthopädische Behandlung bei E. (I-56, I-70). Vom 20. bis zum 23. Dezember 2013 wurde der Kläger orthopädisch im Klinikum Y. stationär behandelt und von dort „beschwerdearm“ in die ambulante Weiterbehandlung entlassen (I-74). Am 17.01.2014 erstattete V. ein sozialmedizinisches Gutachten, das für den Zeitpunkt der Erstattung Arbeitsunfähigkeit ergab, wegen des „relativ kurzen“ Krankheitsverlaufs die Erwerbsfähigkeit des Klägers aber nicht als gefährdet ansah (I-78 f.). Vom 17.02.2014 bis zum 08.03.2014 wurde der Kläger erneut wegen Rückenbeschwerden in der Klinik M. Z. behandelt (I-85). Eine erneute sozialmedizinische Begutachtung durch V. ergab am 02.04.2014 „wegen des langen und unbefriedigenden Krankheitsverlaufs“ eine erhebliche Gefährdung der Erwerbsfähigkeit des Klägers (I-95 f.). Aus stationärer Behandlung im Klinikzentrum H. vom 25.05.2014 bis zum 24.06.2014 wurde der Kläger als arbeitsunfähig entlassen (I-118). Vom 07.01.2015 bis zum 19.01.2015 wurde der Kläger schmerztherapeutisch im C. Krankenhaus U. behandelt (I-127).
Im Frühjahr 2014 machte der Kläger telefonisch Ansprüche aus der Berufsunfähigkeitsversicherung geltend. Die Beklagte trat in die Leistungsprüfung ein. Im Dezember 2014 erklärte die Beklagte mit Schreiben vom 01.12.2014 und vom 17.12.2014, deren Zugang jeweils streitig ist, den Rücktritt vom Versicherungsvertrag. Für letztgenanntes Schreiben hat die Beklagte einen Rückschein als Beleg des Zugangs am 19.12.2014 vorgelegt (I-306). Mit Schreiben vom 03.02.2015 wiederholte die Beklagte den Rücktritt und erklärte außerdem die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung (I-142). Zur Begründung verwies die Beklagte darauf, dass der Kläger am 08.05.2006 wegen „Skoliose der Brustwirbelsäule, Schmerzen“ (I-285) und am 31.05.2006 wegen „Degenerative[r] Veränderungen der Brustwirbelsäule mit rechtskonvexer Skoliose“ behandelt worden sei (I-303).26
Nach Beendigung der Krankschreibung unternahm der Kläger im November und Dezember 2015 einen Versuch, als Taxifahrer zu arbeiten, scheiterte aber bald am langen Sitzen und am Be- und Entladen des Gepäcks. Nach einer kurzen Zeit der Arbeitslosigkeit (01.01. bis 19.01.2016) begann er eine Umschulung zum (..). Noch im Jahr 2016 wurde beim Kläger (..)krebs diagnostiziert. 2018 wurden Lymphmetastasen festgestellt. Er absolvierte in diesem Zusammenhang vom 03.05.2018 bis 31.05.2018 und vom 03.01.2020 bis 24.01.2020 eine psychoonkologische Behandlung in F. (II-372). Trotz dieser Erkrankungen schloss der Kläger die Umschulung erfolgreich ab. Zum 01.10.2019 nahm er eine befristete Tätigkeit beim Ordnungsamt der Stadt U. im uniformierten Außendienst auf und wechselte dort später in den Innendienst. Als seine befristete Stelle nicht verlängert wurde, wechselte er zum 01.12.2022 nahtlos zur Stadt T., wo er in der Stadtkasse mit Vollstreckungen beschäftigt war (II-369). Bereits nach einiger Zeit wechselte er zur Gemeinde I., wo er bis heute in der Anlaufstelle für Flüchtlinge tätig ist und dort insbesondere mit der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz befasst ist (II-707).
Mit Schriftsatz vom 24.08.2020 hat die Beklagte den Kläger unter Bezugnahme auf das erstinstanzlich erstattete Gutachten hilfsweise auf seine ab Oktober 2019 bei der Stadt U. ausgeübte Tätigkeit verwiesen (I-907). Die Abschriften dieses Schriftsatzes sind am 01.09.2020 an die Prozessbevollmächtigten des Klägers versandt worden (I-902).
Der Kläger hat zum Vertragsschluss behauptet, dass der Zeuge S. den Antrag ausgefüllt habe. Er, der Kläger, habe dem Zeugen auch von den weiteren erfolglosen Anträgen auf Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung in den Vorjahren berichtet. Der Zeuge habe jedoch mitgeteilt, dass nur der letzte Antrag angegeben werden müsse. Zu der von der Beklagten eingewendeten Vorerkrankung behauptet der Kläger, dass er im Jahr 2006 von seinem Hausarzt wegen einer Bronchitis zu einer Röntgenuntersuchung bei P. überwiesen worden sei. Bei dieser Untersuchung sei die Skoliose der Brustwirbelsäule als Zufallsbefund bemerkt, ihm gegenüber aber nicht mitgeteilt worden.
Zu seiner selbständigen Tätigkeit als Betreiber eines Imbissbetriebes hat der Kläger behauptet, von Montag bis Samstag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr beschäftigt gewesen zu sein. Von diesen 90 Stunden habe er mindestens 50 bis 60 Stunden selbst gearbeitet. Zwei Mitarbeiter und seine Ehefrau hätten ihn mit einem Stundenanteil von jeweils 15 bis 20 Stunden unterstützt. Er habe innerhalb des Einkaufszentrums und in einem Wagen davor Dönerspezialitäten und andere Speisen hergestellt und verkauft. Den Einkauf habe er selbst und immer allein erledigt. Hierzu habe er wöchentlich etwa fünf Gebinde mit Waren/Lebensmitteln zu je 15 bis 20 kg, ein bis zwei Gebinde zu je 20 bis 30 kg sowie ein Gebinde mit 30 bis 50 kg tragen und im PKW (L.) verladen müssen. Wegen der weiteren Einzelheiten und des typischen Tagesablaufs wird auf den Schriftsatz vom 28.02.2019 (I- 490 f.) verwiesen. Der Kläger habe dann im Jahr 2013 vermehrt Rückenbeschwerden verspürt und sich zuletzt zeitweise im Betrieb auf einen Bügelhocker gestützt.
Wegen der Beschwerden und auch wegen der wirtschaftlich ungünstigen Situation, so hat er weiter behauptet, habe er die von ihm zunehmend als belastend empfundene Selbständigkeit aufgegeben und zum 01.09.2013 eine Arbeit in einem fleischverarbeitenden Betrieb aufgenommen. Dort habe er in Akkordarbeit im Zwei-Schicht-System Dönerspieße „gepackt“. Die Arbeitszeit habe 188 Stunden im Monat betragen. Er habe Lasten von bis zu 30 kg, teilweise auch bis zu 50 kg, vor dem Körper, seitwärts oder auf der Schulter tragen müssen. Jeder Mitarbeiter habe pro Schicht etwa 100 kg Geflügelfleisch verarbeitet. Dieses werde in Portionen von 20 bis 30 kg aus dem Kühlhaus geholt, maschinell oder von Hand flachgeklopft und in einer Maschine gewürzt. Dann würden die Fleischstücke nach und nach aufgespießt, bis Spieße zwischen 15 und 70 kg erreicht seien. Die fertigen Spieße würden in Folie verpackt, mit einer Mittelstange durchstoßen und zum Abtransport bereitgelegt. Zweimal wöchentlich sei er zur Auslieferung in einem Umkreis von bis zu 200 km eingesetzt gewesen (I-10 f.). Diese Tätigkeit könne er seit November 2013 wegen Schmerzen im Rücken und wegen einer Depression nicht mehr ausüben.
Die Beklagte hat behauptet, dem Kläger seien die Rücktrittserklärungen mit Schreiben vom 01.12.2014 und 17.12.2014 zugegangen. Sie hat die vom Kläger behaupteten Tätigkeitsbilder und eine bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit bestritten. Sie hat behauptet, der Kläger sei noch im Jahr 2006 wegen einer Skoliose und degenerativer Veränderungen der Brustwirbelsäule behandelt worden. Die Beklagte weist darauf hin, dass der Kläger trotz eines Grades der Behinderung von 30 die Frage nach einem Schwerbehindertenausweis verneint und auch die weiteren Anträge auf Abschlüsse von Berufsunfähigkeitsversicherungen bei anderen Versicherern im Antragsformular nicht angegeben habe.
Hilfswiderklagend hat die Beklagte ausstehende Versicherungsprämien seit dem 01.10.2014 geltend gemacht (I-695; erweitert I-944) für den Fall, dass „das Gericht von der Wirksamkeit erklärter Rücktritte und der Anfechtung ausgehen sollte“.
Das Landgericht hat nach Beweiserhebung über die bis zum 31.08.2013 ausgeübte selbständige Tätigkeit des Klägers, über die Umstände der Antragstellung und über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Klägers die Klage abgewiesen. Rücktritt und Anfechtung wegen arglistiger Täuschung könnten dahinstehen, weil der Kläger den Nachweis einer bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit nicht geführt habe. Abzustellen sei ausschließlich auf die selbständige Tätigkeit, deren Anforderungen der Kläger zwar bewiesen habe, die er aber bis zuletzt trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen habe ausüben können. Die Beschwerden hätten sich erst während seiner dann aufgenommenen Tätigkeit in der Fleischproduktion verschlechtert. Diese Tätigkeit sei aber zu kurz gewesen, um auf sie für die Beurteilung der Berufsunfähigkeit abstellen zu können. Den Imbiss hätte er notfalls mit einer Hilfsperson im Wege der Umorganisation weiterbetreiben können. Über die Hilfswiderklage der Beklagten hat das Landgericht nicht entschieden, weil es die Wirksamkeit von Rücktritt und Anfechtung offengelassen habe und die innerprozessuale Bedingung deswegen nicht eingetreten sei.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes erster Instanz, der dortigen Anträge und der Einzelheiten der Begründung des Landgerichts wird auf das Urteil (I-1034 ff.) Bezug genommen.
Hiergegen richtet sich die Berufung des Klägers. Er macht geltend, das Landgericht habe fehlerhaft auf seine Ende August 2013 beendete selbstständige Tätigkeit abgestellt. Die Versicherungsbedingungen stellten auf die „zuletzt ausgeübte Tätigkeit“ ab; „prägend“ müsse diese nicht gewesen sein. Außerdem könne die freiwillig aus wirtschaftlichen Gründen aufgegebene Tätigkeit ohnehin nicht mehr „prägend“ gewesen sein. Er rügt außerdem, dass das Landgericht eine nicht ausreichend fachkundige Sachverständige bestellt habe. Diese sei – was zutrifft – Fachärztin für Allgemeinmedizin mit den Zusatzqualifikationen Arbeitsmedizin und Sportmedizin. Zur Beurteilung seiner Beeinträchtigungen sei eine orthopädische und psychiatrische Begutachtung erforderlich. Außerdem rügt er weitere Mängel im Gutachten.
Der Kläger beantragt zuletzt,
- unter Abänderung des angefochtenen Urteils des Landgerichts Detmold vom 05.01.2021 (AZ: 02 O 2/18) wie folgt zu erkennen:
- 1.
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 60.000,00 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz von je 1.500,00 € seit jedem Monatsersten vom 01.12.2013 bis zum 31.03.2017 zu zahlen. - 2.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, an den Kläger über die mit dem Klageantrag zu 1) verlangten Zahlungen hinaus bis zum 31.03.2036 die weiteren bedingungsgemäßen Leistungen zu erbringen. - 3.
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.372,80 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz von je 124,80 € seit dem 01.01.2014, 01.02.2014, 01.03.2014, 01.04.2014, 01.05.2014, 01.06.2014, 01.07.2014, 01.08.2014, 01.09.2014, 01.10.2014 und 01.11.2014 zu zahlen. - 4.
Es wird festgestellt, dass der Kläger bei der Beklagten in der Lebensversicherung Nr. N01 seit dem 01.01.2014 beitragsfrei versichert ist. - 5.
Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von den bei seinen Prozessbevollmächtigten entstandenen vorgerichtlichen Kosten in Höhe von 1.120,62 € freizustellen.
Die Beklagte beantragt,
- die Berufung zurückzuweisen.
Die Beklagte verteidigt die angefochtene Entscheidung. Mit Schriftsatz vom 24.02.2023 hat sie den Kläger vorsorglich erneut auf seine seit dem 01.12.2022 ausgeübte Tätigkeit bei der Stadt T. verwiesen (II-432).
Der Senat hat Beweis erhoben durch die Einholung eines psychiatrischen und eines orthopädischen Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten des Sachverständigen G. vom 28.12.2022 (II- 347 ff.) sowie dessen Ergänzungsgutachten vom 28.12.2023 (II-703 ff.) und auf das Gutachten des Sachverständigen O. vom 12.04.2023 (II-483 ff.) sowie dessen Ergänzungsgutachten vom 05.08.2023 (II-591 ff.) verwiesen. Der Senat hat den Kläger in der Sitzung vom 04.12.2024 persönlich angehört. Im Termin haben beide Sachverständige ihre Gutachten mündlich erläutert. Wegen der Anhörung des Klägers und der Erläuterungen der Sachverständigen nimmt der Senat Bezug auf den Berichterstattervermerk zur Sitzung vom 04.12.2024 (II-850). Den ursprünglich bestimmten Termin zur Verkündung einer Entscheidung hat der Senat mehrfach und im Einverständnis mit den Parteien wegen schwebender Vergleichsverhandlungen verlegt.
Wegen der Einzelheiten des Vortrags in dieser Instanz wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
II.
Die zulässige Berufung hat teilweise Erfolg und führt zur Abänderung der angefochtenen Entscheidung. Die Beklagte hat sich nicht mit Erfolg durch Rücktritt oder Anfechtung von dem abgeschlossenen Versicherungsvertrag gelöst (1.). Ab November 2013 war der Kläger bedingungsgemäß berufsunfähig (2.). Die Beklagte hat den Kläger aber wirksam auf seine neue Tätigkeit als Verwaltungswirt verwiesen, so dass die ihre Leistungen mit dem Ablauf des Dezember 2020 einstellen darf (3.).
1. Keine Loslösung vom Vertrag
Durch die außergerichtlichen Schreiben vom 17.12.2014 und 03.02.2015 – für einen Zugang des vorherigen Schreibens vom 01.12.2014 hat die Beklagte keinen Beweis angetreten – hat sich die Beklagte nicht erfolgreich durch Anfechtung (a) oder Rücktritt (b) vom Vertrag gelöst.
Da der Kläger den Zugang des Schreibens vom 03.02.2015, mit dem die Beklagte den Rücktritt und die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung erklärt hat, nicht bestritten hat und da er jedenfalls nach Vorlage des Rückscheins vom 19.12.2014 zu dem Rücktrittsschreiben vom 17.12.2014 nicht ergänzend Stellung genommen hat, geht der Senat vom Zugang jedenfalls dieser beiden Schreiben aus
Hierzu gilt:
a)
Die von der Beklagten mit Schreiben vom 03.02.2015 erklärte Anfechtung des Versicherungsvertrages wegen arglistiger Täuschung gemäß § 22 VVG, 123 BGB greift nicht durch.
aa)
Der Kläger hat im Antragsformular lediglich objektiv falsche Angaben zu früheren Anträgen auf Abschluss von Berufsunfähigkeitsversicherungen bei anderen Versicherern gemacht (dazu sogleich (3) und bb); die sonstigen Fragen im Antragsformular hat er nicht objektiv unwahr beantwortet.
(1)
Der Kläger hat Fragen zu Vorerkrankungen wegen der in den Arztberichten P. beschriebenen Befunde (BWS-Skoliose; Schmerzen [Bericht vom 08.05.2006, I-285] und degenerative BWS-Veränderungen mit angedeuteter BWS-Skoliose [Bericht vom 31.05.2006, I-303]) nicht falsch beantwortet.
Der Kläger war in den Gesundheitsfragen gefragt worden:
„B4 Sind Sie in den letzten 5 Jahren untersucht, beraten oder behandelt worden hinsichtlich:
(…)
B4.2 Atmungsorgane (z. B. wiederholte oder chronische Bronchitis, Asthma)?
(…)
B4.9 Wirbelsäule, Sehnen, Bänder, Muskeln, Knochen oder Gelenke (z. B. Rückenerkrankungen, Arthrose, Rheuma)?
Nach seinem unwidersprochen gebliebenen Vortrag hatte der Kläger sich wegen einer schmerzhaften Bronchitis zu seinem Hausarzt begeben. Die Bronchitis war zur Frage B4.2 nicht anzugeben, weil dort in dem Klammerzusatz nur nach einer wiederholten oder chronischen Bronchitis beispielhaft gefragt wurde (Hervorhebung durch den Senat) und es dort gerade nicht allgemein heißt „z.B. Bronchitis“. Eine einmalige Bronchitis war – trotz des „z.B.“ in dem Klammerzusatz – nicht erfragt; anders kann die Einschränkung auf „wiederholte oder chronische Bronchitis“ nicht verstanden werden. Hierauf beruft sich die Beklagte auch nicht.
Für eine auf die Frage B4.9 anzugebende Untersuchung, Beratung oder Behandlung wegen Beschwerden im Zusammenhang mit der Wirbelsäule in den letzten 5 Jahren gibt es schon objektiv keine hinreichenden Anhaltspunkte. Solche legt die Beklagte auch nicht dar; erst recht tritt sie, wie auch in er mündlichen Verhandlung vor dem Senat erörtert, keinen tauglichen Beweis an. Aus dem handschriftlichen Arztbericht vom 08.05.2006 (I-285) ergibt sich, dass die BWS-Skoliose lediglich als Vorgeschichte notiert wurde. Zum Anlass der konkreten Untersuchung ist dort nichts notiert. Aus dem etwas ausführlicheren Bericht vom 31.05.2006 (I-303) ergibt sich, dass die Überweisung zur „Thoraxdiagnostik“ erfolgte. Das spricht für den Vortrag des Klägers, er sei von seinem Hausarzt, der über kein Röntgengerät verfügt habe, zur Abklärung der Bronchitis an P. überwiesen worden. Hierfür spricht auch, dass nach dem von der Beklagten als Anlage BLD 4e vorgelegten Bericht des Hausarztes vom 03.12.2007 zu einem Antrag auf Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung bei der D. unter Nr. 2. eingetragen ist: „WS Beschwerden in großen Abständen, in den letzten zwei Jahren erfolgte keine Behandlung wegen o.g. Beschwerden“ (I-300). Dass der untersuchende Arzt P. gleichsam der Vollständigkeit halber die – offenbar bereits zuvor bekannte – BWS-Skoliose berichtet hat, besagt daher nicht, dass der Kläger deswegen auch untersucht, beraten oder behandelt wurde.
Eine Behandlung wegen Rückenbeschwerden in der Klinik M. im Jahr 2004 lag außerhalb des von der Beklagten abgefragten Zeitraums von 5 Jahren.
Nach bestehenden Vorerkrankungen ist der Kläger in dem Antragsformular der Beklagten nicht gefragt worden – anders als in den Formularen der anderen Versicherer –, sondern eben nur nach Untersuchungen, Beratungen oder Behandlungen in den letzten 5 Jahren.
Der Kläger hat damit im Hinblick auf die in den Berichten P. vermerkten Befunde betreffend die Halswirbelsäule schon objektiv keine falschen Angaben gemacht.
(2)
Soweit die Beklagte in der Klageerwiderung einwendet, der Kläger habe trotz eines damaligen Grades der Behinderung von 30 die unter D2 gestellte Frage nach einem Schwerbehindertenausweis verneint, so ist beides richtig, führt aber nicht zu falschen Antworten auf die gestellten Fragen. Denn die Beklagte fragt unter D2 nicht nach einem anerkannten Grad der Behinderung, sondern ausdrücklich nach einem „Schwerbehindertenausweis“ und bittet lediglich in diesem Zusammenhang um die Angabe des Prozentsatzes und weitere Erläuterungen. Ein „Schwerbehindertenausweis“ wird aber erst ab einem Grad der Behinderung von 50 ausgestellt, §§ 2 Abs. 2, 154 Abs. 5 SGB IX. Einen solchen hatte der Kläger bei Antragstellung nicht.
(3)
Objektiv falsche Angaben hat der Kläger jedoch zu der Frage nach anderweitigen Versicherungsanträgen unter D3 gemacht.
Die dortige Frage nach anderweitig abgeschlossenen oder beantragten Berufsunfähigkeitsversicherungen in den letzten fünf Jahren hat der Kläger zwar durch Ankreuzen bejaht, in dem handschriftlichen Zusatz bei den geforderten Erläuterungen aber lediglich den abgeschlossenen und dann wieder aufgelösten Vertrag bei der B. im Jahr 2009 angegeben (I-149). Tatsächlich gab es vor dem hier in Rede stehenden Antrag bei der Beklagten und neben dem vom Kläger im Antrag offenbarten Vertrag bei der B. noch weitere Anträge bei der W. in 2009, bei der D. in 2007 und bei der K. in 2006 (I-451). Ob der Kläger die Frage nach Anträgen bei anderen Versicherern auch im Hinblick auf den abgeschlossenen und sodann wieder aufgelösten Vertrag bei der B. verkürzt und damit falsch beantwortet hat, bedarf keiner Entscheidung.
Ebenfalls bedarf es keiner Entscheidung, ob der Kläger entsprechend seiner Behauptung von dem ihn als Makler unterstützenden Zeugen S. in diesem Zusammenhang mitgeteilt bekam, es komme nur auf den zeitlich letzten Antrag an. Möglicherweise hat ihm der Makler auch gesagt, dass er den Grund für den Widerspruch gegen den Vertrag bei der B. nicht mitteilen müsse, was jeweils gegen Vorsatz und Arglist des Klägers sprechen würde. Schließlich ist auch nicht zu entscheiden, ob dem Kläger eine etwaige Arglist des Maklers zuzurechnen wäre. Denn hierauf kommt es aus den folgenden Gründen nicht an.
bb)
Die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung im Hinblick auf diese anderen Versicherungsanträge scheitert daran, dass sich die Beklagte im Schreiben vom 03.02.2015 nicht auf das Verschweigen der anderweitigen Versicherungsanträge stützt.
In § 22 VVG, der lediglich auf die Vorschriften über die Anfechtung im BGB verweist, ist zwar – anders als für den Rücktritt in § 21 Abs. 1 S. 2 VVG – keine Begründungspflicht für die Anfechtungserklärung normiert. Nach herrschender Ansicht, die der Senat teilt, muss indes der Anfechtungsgrund für den Anfechtungsgegner zumindest erkennbar sein. Andere als die in der Anfechtungserklärung ausgedrückten Gründe kann der Anfechtende nur innerhalb der Anfechtungsfrist „nachschieben“ (Prölss/Martin-Armbrüster, VVG, 32. Aufl. 2024, § 22 Rn. 33; Grüneberg-Ellenberger, BGB, 84. Aufl. 2025, § 143 Rn. 3, jew. m.w.N.).
Ausgehend von diesen Grundsätzen hat die Beklagte den Vertrag nicht wegen der verschwiegenen anderweitigen Anträge wirksam angefochten.
Im Anfechtungsschreiben (I-142) werden zunächst nur die „Gesundheitsstörungen“ sowie die „erfolgten ärztlichen Behandlungen“ im Zusammenhang mit der bereits thematisierten Untersuchung im Jahr 2006 (Skoliose der Brustwirbelsäule) genannt. Außerdem werden Untersuchungen und Behandlungen im Jahr 2004 (also außerhalb des im Antragsformular abgefragten Zeitraums von 5 Jahren) angeführt. In diesem Zusammenhang zitiert zwar die Beklagte die Berichte der Hausärztin des Klägers gegenüber der D., der W. und auch der B. Versicherung. Das Schreiben lässt aber nicht ansatzweise erkennen, dass die Beklagte sich auch deshalb vom Vertrag lösen will, weil der Kläger lediglich den Vertrag bei der B., nicht aber auch die Anträge bei der D. und der W. mitteilte. Im Gegenteil konnte der Kläger das Anfechtungsschreiben nur dahin verstehen, dass die Beklagte sich auf vermeintlich verschwiegene Erkrankungen und deshalb erfolgte Behandlungen bezog und lediglich als Beleg auf die Berichte seiner Hausärztin verwies. Denn da die Beklagte nicht nur von den anderweitigen Anträgen, sondern sogar auch von den Arztberichten, die diesen beigegegen waren, Kenntnis hatte, lag angesichts der ausdrücklichen Frage nach anderweitigen Anträgen nichts näher, als auch hierauf die Anfechtung zu stützen. Da sich die Beklagte auf diese Informationen aber nur als Beleg für frühere Behandlungen berief, ohne auch nur anzudeuten, dass sie sich wegen der Existenz früherer Anträge bei anderen Versicherern getäuscht oder auch nur irritiert fühlte, konnte der Kläger das Anfechtungsschreiben nur so verstehen, dass die anderweitigen Anträge als solche keine Rolle für die Willensbildung der Beklagten spielten.
Die Beklagte hat sich dann erst in der Klageerwiderung auf die nicht mitgeteilten anderweitigen Anträge berufen; zu diesem Zeitpunkt war die Anfechtungsfrist lange abgelaufen.
b)
Aus ähnlichen Gründen hat der mit Schreiben der Beklagten vom 17.12.2014 und sodann erneut mit Schreiben vom 03.02.2015 erklärte Rücktritt das Vertragsverhältnis nicht beendet.
Wegen der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigeobliegenheit, die gemäß § 19 Abs. 2 VVG Voraussetzung des Rücktritts ist, verweist der Senat auf die obigen Ausführungen zu den fehlerhaften Angaben auf die im Antragsformular gestellten Fragen. Ob der Rücktritt gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 VVG innerhalb der dort normierten Frist von einem Monat erklärt wurde, kann dahinstehen. Jedenfalls hat die Beklagte entgegen § 21 Abs. 1 S. 3 VVG zur Begründung des Rücktritts nicht auf die anderweitigen Versicherungsanträge verwiesen. Die vorstehenden Ausführungen zur Mitteilung der Anfechtungsgründe gelten inhaltlich auch für die tatsächliche Begründung des Rücktritts.
c)
Der Versicherungsvertrag ist daher nicht durch Anfechtung oder Rücktritt beendet worden.
2. Bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit
Der Kläger hat im Berufungsverfahren den Nachweis bedingungsgemäßer Berufsunfähigkeit erbracht.
a)
Das Landgericht hat für die Frage der bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit zu Recht auf die vom Kläger bis einschließlich August 2013 ausgeübte Tätigkeit als selbständiger Betreiber eines Imbissbetriebes abgestellt. Es bedarf daher keiner näheren Ausführungen dazu, dass im Übrigen auch für die Tätigkeit in dem fleischverarbeitenden Betrieb – mit teilweise weitergehenden körperlichen Anforderungen – Berufsunfähigkeit bestand.
Grundsätzlich kommt es zwar nach dem Stichtagsprinzip auf die im Zeitpunkt des Eintritts behaupteter Berufsunfähigkeit ausgeübte Tätigkeit an (BGH, Urteil vom 22.09.1993, IV ZR 203/92, VersR 1993,1470 ff., Rn. 21 - juris). Bei einem leidensbedingten Wechsel des Berufs vor Eintritt des Versicherungsfalls aber ist abzustellen auf die letzte konkrete Berufsausübung, so wie sie „in gesunden Tagen“ ausgestaltet war, d. h. solange die Leistungsfähigkeit des Versicherten noch nicht gesundheitsbedingt eingeschränkt war (BGH, Urteil vom 14.12.2016, IV ZR 527/15, r+s 2017, 320 ff. Rn. 23).
Ausgehend von diesen Grundsätzen ist auf die Tätigkeit des Klägers als selbständiger Betreiber eines Imbissbetriebes abzustellen. Schon vor dem Landgericht hat der Kläger erklärt, dass er die ursprünglich ausgeübte Tätigkeit körperlich irgendwann nicht mehr habe bewältigen können, da ihm das lange Stehen Probleme bereitet habe (Seite 1 der Sitzungsniederschrift vom 14.08.2018, eGA-I 382). Zwar hat der Kläger gegenüber der erstinstanzlich beauftragten Sachverständigen mitgeteilt, dass er nach den Behandlungen 2003/2004 „im Wesentlichen über einen längeren Zeitraum bis etwa 2013/2014 beschwerdefrei“ gewesen sei; erst im Herbst 2013 habe er sich zunächst zur Hausärztin und dann in orthopädische Behandlung wegen zunehmender Rückenschmerzen begeben (I-853); den Imbiss habe er aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben (I-862). Ähnliches legt der Kläger auch mit der Berufungsbegründung dar und verweist hierzu ergänzend darauf, dass der erwirtschaftete Fehlbetrag im Jahr 2012 über 7.000,00 € und im Jahr 2013 über 59.000,00 € betragen habe (II-52). Der mit der psychiatrischen Begutachtung beauftragten Sachverständigen G. beschreibt hingegen die ihm vom Kläger mitgeteilten Motive differenzierter:
„Der mit der Selbstständigkeit verbundene Stress und die chronischen orthopädischen Beschwerden hätten vor dem Hintergrund einer insgesamt ungünstigen wirtschaftlichen Prognose schließlich zur Aufgabe der Tätigkeit geführt“ (II-361).
Im Termin vor dem Senat hat der Kläger schließlich erklärt, dass er im August 2013 bereits seit etwa zwei Jahren über Rücken- und Kopfschmerzen geklagt habe, sich bis dahin aber noch habe „behelfen“ können (II-851). Dass es nach seiner Einschätzung „am Schluss wirtschaftlich nicht mehr ging“ hat der Kläger vor dem Senat überzeugend so erläutert, dass dies auf seiner gesundheitsbedingt reduzierten Leistungsfähigkeit beruhte.
Der Senat ist davon überzeugt, dass die Rückenbeschwerden des Klägers und die damit verbundenen Schmerzen jedenfalls ein maßgeblicher Grund für die Aufgabe der selbständigen Tätigkeit waren, so dass die unmittelbar anschließend aufgenommene, nach kurzer Zeit aber gescheiterte Tätigkeit in der Fleischproduktion nicht die letzte vom Kläger in gesunden Tagen ausgeübte Tätigkeit darstellt. Die Erwerbsbiografie des Klägers war von seiner Ausbildung bis zu seiner Erkrankung zu keiner Zeit von Arbeitslosigkeit unterbrochen. Auch während seiner Erkrankung war er sofort bemüht, eine andere berufliche Perspektive zu entwickeln. Eine Tätigkeit als Taxifahrer scheiterte ebenfalls an Rückenbeschwerde. Nach einer sehr kurzen Zeit der Arbeitslosigkeit begann er eine Umschulung zum Verwaltungswirt, die er trotz einer Krebserkrankung abschloss. Auch in seinem neuen Beruf war der Kläger trotz fehlender Anschlussbeschäftigung nach einer ersten Befristung und trotz einer von ihm als unglücklich empfundenen Arbeitsplatzwahl bei der Gemeindekasse stets durchgängig beschäftigt, bis er seine bis heute ausgeübte Tätigkeit bei der Gemeinde I. fand. Der Senat hat den Kläger als differenziert antwortende, besonnene und verantwortungsbewusste Persönlichkeit kennengelernt, die sich und die eigene Familie stets selbst versorgt hat. Seine Angaben zu seinen Tätigkeiten und zu seinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen waren sachlich und ohne Übertreibungen. Wegen dieses persönlichen Eindrucks von dem Kläger, der durch die lückenlose Erwerbsbiografie und die trotz massiver gesundheitlicher Beeinträchtigungen erfolgreich absolvierte Umschulung bis hin zu einer verantwortungsvollen Tätigkeit im öffentlichen Dienst ergänzt wird, hat der Senat aufgrund der persönlichen Anhörung des Klägers nach Gesamtwürdigung aller Umstände keine vernünftigen Zweifel daran, dass es trotz wirtschaftlich ungünstiger Rahmenbedingungen gerade auch die immer größer werdenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen waren, die den Kläger zur Aufgabe seiner Selbständigkeit veranlassten.
b)
Die selbständige Tätigkeit als Imbissbetreiber war dadurch geprägt, dass der Kläger regelmäßig von montags bis samstags in der Zeit von 06:30 Uhr oder 07:00 Uhr bis zum Abschließen der Geschäftsräume des Einkaufszentrums um 21:00 Uhr beschäftigt war.
Früh morgens bereitete er mit seiner Ehefrau die Speisen vor. Danach nahm er bis gegen 10 oder 11 Uhr den Einkauf im Großmarkt vor, wobei er die Gebinde mit einem Gewicht von jedenfalls 10 bis 15 kg aus den Regalen heben und später in seinen PKW verladen musste. Er beschäftigte zwei Mitarbeiter, die bereits während der einkaufsbedingten Abwesenheit des Klägers mit dem Verkauf im Imbiss begannen und dem Kläger – je nach Kundenbesuch – beim Ausladen der eingekauften Waren helfen konnten. Ganz überwiegend waren die Mitarbeiter aber nicht gleichzeitig für den Kläger im Einsatz. Nach dem Mittagsgeschäft war der Kläger vorübergehend allein tätig und bediente mit Hilfe einer dort installierten Kamera auch den vor dem Einkaufszentrum abgestellten Verkaufswagen. Das Abendgeschäft betrieb er wieder mit einem seiner Mitarbeiter. Nach der Schließung des Einkaufszentrums für den Kundenverkehr führte der Kläger mit einem seiner Mitarbeiter oder mit seiner Ehefrau die nötigen Reinigungsarbeiten durch. Wurden sie bis zum Abschließen der Geschäftsräume um 21 Uhr nicht fertig, mussten die nicht erledigten Arbeiten am nächsten Morgen nachgeholt werden.
Diese Feststellungen beruhen auf den Schilderungen des Klägers im Senatstermin und seinen sich hiermit deckenden Angaben gegenüber den Gutachtern. Die Bekundungen der vor dem Landgericht vernommenen Zeuginnen J., der Ehefrau des Klägers, und X., seiner Mitarbeiterin, bestätigen seine Angaben. Der Senat stützt seine Überzeugung insbesondere auch deshalb auf die glaubhaften Angaben des Klägers, weil er auch bei der Schilderung der Anforderungen seiner Tätigkeit und seiner gesundheitlichen Beeinträchtigungen eher geneigt war, diese jeweils zu relativieren. So hat er betont, dass er im Großmarkt nicht alle Einkäufe auf das Band habe legen müssen, was er als Erleichterung empfunden habe. Auch hat er die Hilfe seiner Mitarbeiterin beim Ausladen der Einkäufe betont.
Vor diesem Hintergrund bestehen zur Überzeugung des Senats auch keine Zweifel an der Richtigkeit der Schilderungen des Klägers von den Anforderungen und Bedingungen seiner ab September 2013 kurz ausgeübten Tätigkeit in der Fleischproduktion, die durch das Tragen schwerer Dönerspieße von 25 bis 30 kg in kalter Umgebung geprägt war. Auch hier hat der Kläger betont, dass noch schwerere Spieße von bis zu 60 kg „natürlich“ nicht allein getragen werden mussten.
c)
Der Kläger war spätestens ab November 2013 bedingungsgemäß berufsunfähig. Er konnte seine zuletzt in gesunden Tagen ausgeübte, vorstehend beschriebene selbständige Tätigkeit als Betreiber eines Imbissbetriebes krankheitsbedingt zu mindestens 50 % nicht mehr ausüben, § 1 Abs. 1 AVB-BU.
aa)
Die Feststellungen des Landgerichts, das gestützt auf das eingeholte Gutachten der erstinstanzlich beauftragten Sachverständigen HN. (Fachärztin für Allgemeinmedizin) den Nachweis einer bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit als nicht geführt angesehen haben, begegnen Vollständigkeits- und Richtigkeitszweifeln (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO), so dass eine Neufeststellung durch den Senat geboten war. Die erstinstanzlich tätig gewesene Sachverständige hat angenommen, dass sich der Kläger erst im Herbst 2013, also nach Beendigung seiner Selbstständigkeit, wegen der Rückenbeschwerden in ärztliche Behandlung begeben habe. Die Beschwerden seien durch die ungünstigen Arbeitsbedingungen bei der neuen Tätigkeit des Klägers entstanden (I-868). Die Tätigkeit im Imbissbetrieb sei hingegen gerade wegen der wechselnden Körperpositionen und der auch sonst abwechslungsreichen Tätigkeit für ihn ideal gewesen (mündliche Erläuterung, I-994).
Gegen diese Feststellungen des Landgerichts hat der Kläger erfolgreich Vollständigkeits- und Richtigkeitszweifel eingewendet. Die Schwierigkeiten, die gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Klägers zu fassen, machen im Streitfall zumindest eine orthopädische und wegen der ausgeprägten Schmerzproblematik auch eine psychiatrische Begutachtung erforderlich. Außerdem hat das Landgericht die vom Kläger beschriebenen Beeinträchtigungen während seiner selbständigen Tätigkeit, die er zu kompensieren versucht habe, nicht darauf überprüft, ob der Kläger nicht mit einer Fortsetzung dieser Tätigkeit Raubbau an seiner Gesundheit betrieben hat.
bb)
Beim Kläger liegt nach dem Ergebnis der vom Senat angeordneten Begutachtung durch die Sachverständigen G. (Psychiatrie) und O. (Orthopädie) seit dem Jahr 2013 eine ausgeprägte und chronifizierte Schmerzstörung vor, wegen derer er jedenfalls ab November 2013, dem Zeitpunkt seiner ersten und danach lang andauernden Krankschreibung, zu mindestens 50 % nicht mehr in der Lage war, seinen vorstehend beschriebenen Beruf auszuüben.
Der orthopädische Sachverständige O. hat beschrieben, dass sich der Kläger wegen der Schmerzen erstmals nach langer Zeit wieder im November 2013 in Behandlung begeben habe. Es sei typisch für ein chronifiziertes Schmerzsyndrom, dass orthopädische Ursachen nicht festgestellt werden könnten und daher auch keine orthopädische Behandlung möglich sei, sodass lediglich eine psychologische, psychiatrische und schmerztherapeutische Behandlung stattfinden könne (II-507). Der Sachverständige O. hat ausgeführt, dass beim Kläger mit Stadium III nach Gerbershagen das höchstmögliche Chronifizierungsstadium einer Schmerzstörung vorlag (II-507 f.). Es sei auch nicht entscheidend, auf welche der beiden zuletzt ausgeübten Tätigkeiten abgestellt werde. Erläuternd hat der Gutachter im Ergänzungsgutachten auf entsprechende Einwendungen der Beklagten ausgeführt, dass das Phänomen „chronisches Schmerzgeschehen stärkster Ausprägung bei unklarem orthopädischen Befund“ in der Tat schwer nachvollziehbar sei. Es sei aber trotzdem sehr häufig Realität (II-592). Es sei aus medizinischer Sicht „unstrittig, dass es orthopädisch unerklärbare Schmerzen gibt, die aus sich heraus zu entsprechender Unfähigkeit führen, den bisher ausgeübten Beruf weiterhin auszuüben“ (II-595).
Im Rahmen seiner mündlichen Erläuterung des Gutachtens hat der Sachverständige O., der dem Senat aus einer Vielzahl von Verfahren als kompetenter Gutachter auf orthopädischem Fachgebiet bekannt ist, überzeugend ausgeführt, dass eine Schmerzstörung der Stufe III nach Gerbershagen definitionsgemäß gekennzeichnet sei durch ein Versagen in Familie, Beruf und Gesellschaft. Besonders plastisch hat der Sachverständige beschrieben, dass bei einem solchen Patienten für eine lange Zeit, also über deutlich mehr als drei Monate, „erst einmal nichts mehr geht“ (II-856). Einzig die Hypothese, so der Sachverständige O., die berichteten Schmerzen könnten beim Kläger nicht oder nicht in dem angegebenen Umfang vorhanden gewesen sein, könnten dem Nachweis einer Berufsunfähigkeit entgegenstehen. Diese Hypothese hat der Sachverständige aber gleichsam im selben Atemzug widerlegt. Ebenso wie im Ausgangsgutachten (II-509 f.) hat der Sachverständige O. auch im Senatstermin (II-857) betont, dass die Beeinträchtigungen, insbesondere die Schmerzproblematik, durch Berichte über ambulante und stationäre Behandlungen und insbesondere durch zwei sozialmedizinische Begutachtungen für die hier in Rede stehende Zeit ab Ende 2013 zeitnah und umfassend dokumentiert wurden. Auch der Senat schließt mit der für ein positives Beweisergebnis (Berufsunfähigkeit) notwendigen Gewissheit aus, dass der Kläger, der in seinem Leben immer gearbeitet und trotz einer Krebserkrankung eine Umschulung erfolgreich abgeschlossen hat, damals die Beschwerden aggraviert haben könnte.
Mit dem Sachverständigen O. hat daher auch der Senat keine Zweifel, dass bei dem Kläger eine chronifizierte Schmerzstörung schwerster Ausprägung vorlag, die es ihm spätestens ab November 2013 nicht mehr ermöglichte, seinen Beruf zu mindestens 50 % auszuüben.
Dieser Einschätzung hat sich nach seinen Ausführungen im Termin vor dem Senat auch der psychiatrische Sachverständige G. angeschlossen. Dieser ist zwar zunächst aus psychiatrischer Sicht nicht von einer 50-prozentigen Beeinträchtigung der Berufsfähigkeit ausgegangen, weil es trotz der vom Kläger nachvollziehbar geschilderten psychischen Beeinträchtigungen, auch und gerade wegen der Schmerzproblematik, keine Fehlzeiten bei den beiden ausgeübten Tätigkeiten gegeben habe und weil jedenfalls bis November 2013 die psychiatrische Behandlung, sei es durch Gespräche, sei es durch Medikamente, nicht intensiviert worden sei (II-384 f.). Im Senatstermin ist dann herausgearbeitet worden, dass die psychiatrische Begutachtung, wie sie im Ausgangs- und im Ergänzungsgutachten vorgenommen wurde, zu sehr auf die Auswirkungen der dokumentierten Schmerzsymptomatik auf die Psyche des Klägers, insbesondere im Sinne einer depressiven Erkrankung fokussiert war. Erörtert hat der Sachverständige G. auch, ob bei einer bestehenden Depression der Schmerz möglicherweise verstärkt wahrgenommen wurde, was er beides verneint hat (II-855). Diese vordergründig erörterten Wechselwirkungen zwischen Schmerzerleben und etwaiger Depression besagen aber nichts dazu, ob auch aus psychiatrischer Sicht beim Kläger für sich genommen, d.h. ohne eine sonst festzustellende Krankheit „auf psychiatrischem Fachgebiet“, eine schwere chronizifierte Schmerzstörung im relevanten Zeitraum vorlag, die die Berufsfähigkeit des Klägers beeinträchtigte. Auf diese Frage hat der Sachverständige G. mitgeteilt, dass der Kläger wegen einer chronischen Schmerzstörung der Stufe III nach Gerbershagen auch nach seiner Einschätzung zu deutlich weniger als 50 % bedingungsgemäß berufsfähig war.
Der Senat folgt dieser übereinstimmenden Einschätzung beider Sachverständiger aus eigener Überzeugung.
Der Kläger war daher ab November 2013 berufsunfähig.
Nach den überzeugenden Ausführungen von O. war zu diesem Zeitpunkt mit einer längerfristigen Erkrankung zu rechnen. Es bestehen für den Senat mit den Sachverständigen keine Zweifel, dass der Zustand der Berufsunfähigkeit jedenfalls mehr als 6 Monate ununterbrochen bestand (§ 1 Abs. 3 AVB-BU). So wurde der Kläger auch nach stationärer Behandlung im Klinikzentrum H. vom 25.05.2014 bis zum 24.06.2014 arbeitsunfähig entlassen. Damit ist Berufsunfähigkeit eingetreten.
3. Verweisung
Die Beklagte hat den Kläger indes mit Schriftsatz vom 24.08.2020, dem Kläger zugegangen im September 2020, gemäß § 1 Abs. 4 a) AVB-BU wirksam auf seine neue Tätigkeit als Verwaltungswirt verwiesen.
Der Schriftsatz der Beklagten vom 24.08.2020 erfüllt die an eine formell wirksame Einstellungsmitteilung gestellten Anforderungen (a). Der Kläger übte (und übt) auch eine andere, seiner Ausbildung und seinen Fähigkeiten sowie seiner bisherigen Lebensstellung entsprechende Tätigkeit aus (b).
a)
Der Schriftsatz vom 24.08.2020 enthält eine formell wirksame Einstellungsmitteilung.
Der Versicherer, der im Verfahren der Erstprüfung seine Pflicht zur Leistung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung anerkannt hat, wird nach § 174 Abs. 1 VVG, § 16 Abs. 1 AVB-BU erst mit dem Ablauf des dritten Monats nach Zugang einer Mitteilung, dass die Leistungen eingestellt werden, von seiner Leistungspflicht frei. Diese Mitteilung muss eine nachvollziehbare Begründung dafür geben, warum die Leistungspflicht des Versicherers enden soll. Denn sie soll die Informationen gegeben, die der Versicherungsnehmer benötigt, um sein Prozessrisiko abschätzen zu können (OLG Saarbrücken, Urteil vom 25.02.2015, 5 U 31/14, VersR 2016, 1297, Rn. 73; Prölss/Martin-Lücke, VVG, 32. Aufl. 2024, § 174 Rn. 23). Hat sich nicht der Gesundheitszustand verändert, der Versicherungsnehmer aber bedingungsgemäß zu berücksichtigende neue Kenntnisse erworben, die eine Vergleichstätigkeit ermöglichen, muss in der Mitteilung eine berufsbezogene Vergleichsbetrachtung angestellt werden. Die Anforderungen hieran sind aber dann geringer, wenn bei einer konkreten Verweisung der Versicherte den neuen Beruf bereits ausübt, er die Tätigkeit also schon kennt (BGH, Urteil vom 03.11.1999, IV ZR 155/98, VersR 2000, 171 ff., Rn. 33). Gleiches gilt für eine Einstellungsmitteilung, wenn ein Versicherungsnehmer seine eingetretene Berufsunfähigkeit im Prozess beweist.
Diesen Grundsätzen genügt die Einstellungsmitteilung im Schriftsatz der Beklagten vom 24.08.2020. Auf eine Verbesserung des Gesundheitszustandes stützt sich die Beklagte nicht. Gestützt wird die Verweisung – für den Kläger auch unabhängig von seiner anwaltlichen Beratung erkennbar – auf die nach erfolgreicher Umschulung seit Anfang Oktober 2019 konkret ausgeübte Tätigkeit. Da aber der Kläger sowohl seine bis zum Eintritt der behaupteten Berufsunfähigkeit ausgeübte(n) Tätigkeit(en) als auch seine neue Beschäftigung hinsichtlich Einkommen, Anforderungen, sozialem Ansehen etc. kannte, verfügte er unabhängig von etwaigen Schilderungen der Beklagten über die Informationen, die ihm sonst durch die Einstellungsmitteilung zur Verfügung gestellt werden sollen, um das Risiko abzuschätzen, das mit einer notfalls gerichtlichen Verteidigung gegen die Einstellungsmitteilung verbunden wäre.
b)
Die neue Tätigkeit des Klägers entspricht auch seiner Ausbildung, seinen Fähigkeiten sowie seiner bisherigen Lebensstellung, § 1 Abs. 4 a) AVB-BU.
Der Ausbildung und den Fähigkeiten des Klägers entspricht die neue Stellung schon deshalb, weil er sich durch die Umschulung von einer zuvor ausgeübten ungelernten Tätigkeit zu einem Ausbildungsberuf entwickelt hat. Auch die Lebensstellung des Klägers hat sich nicht nachteilig entwickelt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Kläger mitgeteilt, dass er in seiner jetzigen Tätigkeit etwa ein solches Einkommen erzielt wie damals als Selbständiger. Sein Einkommen in der Fleischproduktion hat er als geringfügig besser als jetzt („ein Tucken besser“, II-854) bezeichnet; auch wenn man darauf abstellen wollte, wären die Einkommen als vergleichbar anzusehen. Das gesellschaftliche Ansehen eines Sachbearbeiters im öffentlichen Dienst ist gegenüber den zuvor ausgeübten Tätigkeiten nicht geringer, auch wenn der Kläger zuvor selbständig gewesen ist.
Insgesamt hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung auch in keiner Weise in Abrede gestellt, dass er sich auf die neue Tätigkeit verweisen lassen muss. Folgerichtig hat er schon in erster Instanz inhaltlich nicht auf die mit Schriftsatz vom 24.08.2020 erklärte Verweisung reagiert.
c)
Die berechtigte Einstellungsnachricht aus dem Schriftsatz der Beklagten vom 24.08.2020 ist dem Kläger frühestens im September 2020 zugegangen (I-902: Abvermerk 01.09.2020). Die Leistungspflicht endet nach Ablauf des dritten auf den Zugang folgenden Monats, § 16 Abs. 1 S. 3 AVB-BU. Damit endete die Leistungspflicht mit dem Ablauf des Monats Dezember 2020.
4. Ergebnis
Wegen der im November 2013 eingetretenen bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit des Klägers ergeben sich folgende Ansprüche:
a)
Die Beklagte schuldet gemäß § 5 Abs. 1 AVB-BU die Zahlung der vereinbarten Rente in Höhe von 1.500,00 € monatlich im Voraus ab dem auf den Eintritt der Berufsunfähigkeit folgenden Monat, §§ 3 Abs. 1 a), 5 Abs. 1 AVB-BU. Daher ist die Rentenzahlung ab Dezember 2013 geschuldet. Ab diesem Zeitpunkt hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung vom 04.12.2024 auch Zahlung beantragt, nachdem zuvor erörtert worden ist, dass die Bezifferung rückständiger Renten im Berufungsantrag zu 1) (40 Monate zu je 1.500,00 € = 60.000,00 €) nicht zu der dort beantragten Zinsstaffel (49 Monate) passt. Die Beklagte hat zu diesem Antrag rügelos verhandelt. Soweit der Kläger damit seinen Antrag um die Rente für Dezember 2013 erweitert haben sollte, ist dies sachdienlich.
Antragsgemäß zuzusprechen sind daher die rückständigen Renten, die der Kläger mit seinem bezifferten Berufungsantrag zu 1) von Dezember 2013 bis einschließlich März 2017 geltend macht (40 x 1.500,00 € = 60.000,00 €).
Wegen der darüber hinaus bis zum Erlöschen des Anspruchs auf Rentenzahlung mit Ablauf des Monats Dezember 2020 wegen der dem Kläger im September 2020 zugegangenen Einstellungsmitteilung gemäß § 16 Abs. 1 S. 3 AVB-BU ist die mit dem Berufungsantrag zu 2) geltend gemachte Feststellung der Verpflichtung zur Gewährung bedingungsgemäßer Leistungen bis zum 31.12.2020 auszusprechen; für den darüber hinaus geltend gemachten Zeitraum bleibt die Klage unter teilweiser Zurückweisung der Berufung abgewiesen.
b)
Der Anspruch auf Rückzahlung geleisteter Beträge trotz Beitragsbefreiung wegen eingetretener Berufsunfähigkeit besteht ebenfalls ab dem auf den Eintritt der Berufsunfähigkeit folgenden Monat, § 5 Abs. 3 AVB-BU.
Der Beitrag beträgt ausweislich des Versicherungsscheins (I-24) monatlich 124,67 €. Der vom Kläger mitgeteilte geringfügig höhere Beitrag von 124,80 € ist nicht nachvollziehbar. Beantragt hat der Kläger nur die Rückzahlung der ab dem 01.01.2014 gezahlten Beiträge. Den auf Rückzahlung der Beiträge gerichteten Berufungsantrag zu 3) hat der Kläger im Gegensatz zu dem auf Zahlung der monatlichen Rente gerichteten Antrag zu 1) nicht angepasst. Im Termin vom 04.12.2024 hat der Kläger mitgeteilt, Beiträge bis einschließlich März 2014 gezahlt zu haben. Das ergibt einen Anspruch auf Rückzahlung geleisteter Beiträge in Höhe von 374,28 € (= 3 x 124,76 €).
Darüber hinaus ist die Feststellung auszusprechen, dass der Kläger von der Pflicht zur Zahlung der Beitragspflicht befreit ist. Beantragt hat der Kläger diese Feststellung ebenfalls erst ab dem 01.01.2014. Mit der erfolgreichen Verweisung setzt die Pflicht zur Beitragszahlung zum 01.01.2021 wieder ein, § 16 Abs. 1 S. 4 AVB-BU.
Wegen der mit dem Berufungsantrag zu 3) geltend gemachten weiteren Beitragsrückzahlungen und wegen des über den 31.12.2020 hinausreichenden Berufungsantrages zu 4) bleibt die Klage unter teilweiser Zurückweisung der Berufung abgewiesen.
c)
Zinsen auf die bis dahin fällig gewordenen Renten kann der Kläger unter dem Gesichtspunkt des Verzuges gemäß § 288 Abs. 1 BGB ab dem 19.12.2014 verlangen. Mit dem durch Rückschein nachgewiesenen Zugang der Rücktrittserklärung, mit der die Beklagte auch die Erfüllung der Rentenleistungen ernsthaft und endgültig verweigert hat, ist Verzug hinsichtlich der bis dahin fällig gewordenen Renten eingetreten.
Zinsen auf die zum jeweiligen Monatsanfang fällig werdenden künftigen Renten kann der Kläger ebenfalls aus Verzug ab dem ersten Tag eines jeden Monats ab Januar 2015 verlangen.
Der Anspruch auf Rückzahlung der in den Monaten Januar bis März 2014 gezahlten Beiträge ist ab Rechtshängigkeit gemäß § 291 zu verzinsen. Für einen früheren Verzugseintritt ist nichts vorgetragen. Insbesondere kann wegen des erklärten Rücktritts und der Anfechtung nicht angenommen werden, dass eine Ablehnung der beanspruchten Versicherungsleistungen auch die Rückzahlung der noch bis März 2014 gezahlten Prämien umfasste. Hinsichtlich dieser Forderung liegt damit keine endgültige und ernsthafte Erfüllungsverweigerung vor.
d)
Der Anspruch auf Freistellung von außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten ergibt sich aus § 286 Abs. 1 BGB.
Die Beklagte befand sich aus den genannten Gründen mit dem Zugang des Schreibens vom 17.12.2014 mit den Rentenzahlungen in Verzug. In der Klageerwiderung hat sie selbst dargelegt, dass die jetzigen Prozessbevollmächtigten des Klägers erst nach Verzugseintritt mandatiert wurden (I-234), was sich der Kläger als ihm günstigen Vortrag stillschweigend zu eigen gemacht hat.
Da der Kläger lediglich Freistellung von den eingegangenen Anwaltskosten verlangt, kommt es auf die von der Beklagten bestrittene Erstellung einer die Fälligkeit begründenden Kostennote nicht an. Der vom Kläger geltend gemachte Befreiungsanspruch kann auch vor Fälligkeit der eingegangenen Verbindlichkeit bestehen, § 257 S. 2 BGB.
Für die Berechnung der Anwaltsgebühren gilt:
Im Zeitpunkt der Mandatierung (März 2015) waren Rentenzahlungen in Höhe von 16 Monaten (Dezember 2013 bis März 2015), also insgesamt in Höhe von 24.000,00 € rückständig. Hinzu kommt der geltend gemachte Anspruch auf Rückzahlung geleisteter Beiträge (374,28 €). Für die geltend gemachten künftigen Rentenleistungen ergibt sich ein Gegenstandswert von Höhe des 3,5fachen Jahresbetrages abzüglich eine Abschlags für das positive Feststellungsbegehren, also 50.400,00 € (42 x 1,500,00 € x 0,8). Für die künftige Beitragsbefreiung ergibt sich der 3,5fache Jahreswert, wegen des negativen Begehrens ohne Abschlag, also 5.239,92 € (= 42 x 124,76 €).
Aus dem Gegenstandswert von 80.014,20 € (= 24.000,00 € + 374,28 € + 50.400,00 € + 5.239,92 €) errechnet sich nach damaligen Gebühren die geltend gemachte 0,65 Geschäftsgebühr von 921,70 € (1.418,00 € x 0,65). Zuzüglich Pauschale (20,00 €) und Umsatzsteuer (19 %) ergeben sich Anwaltsgebühren in beantragter Höhe von 1.120,62 €.
Eine Reduzierung des zuzusprecheden Anspruchs auf Befreiung von den außergerichtlich eingegangenen Anwaltskosten wegen des Teilunterliegens im Rechtsstreit ist nicht veranlasst. Die vorstehenden, die Höhe der Gebühren bestimmenden Forderungen waren berechtigt und sind dem Kläger auch im Rechtsstreit zuzusprechen. Die teilweise Klageabweisung resultiert – bis auf die geringfügige Zuvielforderung im Hinblick auf die Rückzahlung von Beiträgen – aus der von der Beklagten erst deutlich nach der Mandatierung der Anwälte erklärten Verweisung des Klägers auf seine neue Tätigkeit.
5. Hilfswiderklage
Über die Hilfswiderklage ist nicht zu entscheiden. Diese ist nach der Erklärung des Unterbevollmächtigten der Prozessbevollmächtigten der Beklagten im Senatstermin vom 04.12.2024 gestellt für den Fall, dass die Klage abgewiesen wird und der Vertrag wirksam ist. Diese prozessuale Bedingung ist wegen der teilweisen Verurteilung der Beklagten nicht eingetreten.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Bei der Bemessung des wechselseitigen Obsiegens und Unterliegens ist nicht auf den Gebührenstreitwert abzustellen, weil dieser für die in die Zukunft gerichteten Anträge betreffend die Rentenzahlungen und die Beitragsbefreiung auf den 3,5fachen Jahreswert begrenzt ist und damit den wirtschaftlichen Wert dieser Anträge im Hinblick auf die weit darüber hinausgehende Laufzeit des Vertrages nicht angemessen abbildet. Abzustellen ist vielmehr auf den Wert des geltend gemachten Anspruchs, wobei einem auf Gewährung künftiger Berufsunfähigkeitsleistungen gerichteten Titel stets das Risiko des Erlebens, der Gesundung und der Verweisung anhaftet. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte bemisst der Senat das Unterliegen des Klägers wegen der vergleichsweise baldigen Verweisung auf seine neue Tätigkeit und der noch langen Laufzeit des Vertrages mit zwei Dritteln.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10 Satz 2, § 711 ZPO.
Sie haben Fragen zum OLG Urteil über die die rechtskräftige Deutung von BU-Gesundheitsfragen im Leistungsfall bei einer Berufsunfähigkeitsrentenabsicherung (BU), wenden Sie sich direkt hier an die zuständige Instanz.
Oder Sie schauen sich jetzt unser bAVTutorial: Berufsunfähigkeit: BU-Gesundheitsfragen sind nicht interpretierbar, auch nicht für den Versicherer im Leistungsfall einfach erklärt an und viele Fragen werden Ihnen von Felix und seinem Team bereits im Tutorial beantwortet.
WEITERE FACHINFORMATIONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM THEMA:
- STEUEROPTIMIERTE KAPITALAUSZAHLUNG: DIE FÜNFTELUNGSREGELUNG EINFACH ERKLÄRT
- WIE KANN EINE RENDITE IN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE AUSFALLEN
LIEBER DAS FACHTHEMA UNTERWEGS ANHÖREN, HIER GEHT ES ZUM BAV-PODCAST:
SELBSTVERSTÄNDLICH STELLEN WIR AUCH TUTORIALS ÜBER DIE BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE ZUR VERFÜGUNG:
#bavprofis - Ihr Partner für die betriebliche Altersversorgung und der digitalen bAV Verwaltung und der vollständigen Kommunikation für alle Sinne des Menschen.
bAVProfis® - News rund um die betrieblichen Altersvorsorge by bAVProfis.